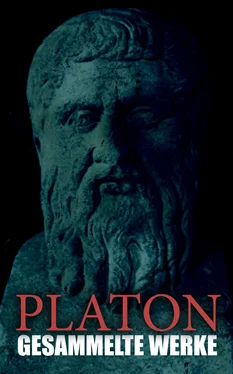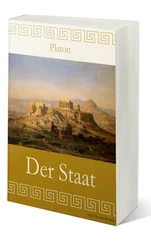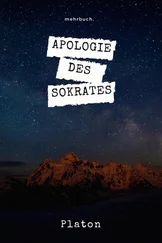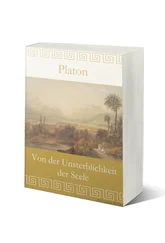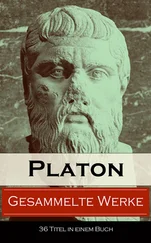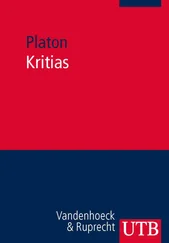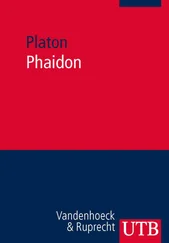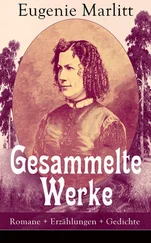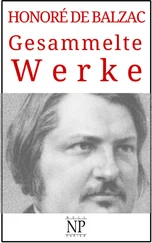Aber Sinn und Geltung bekommen die Ideen erst dadurch, daß sie sich auf Sinnendinge beziehen. Ein Hauptmittel dazu ist die Mathematik , die zwischen dem Vernunft-Denken und den sinnlichen Wahrnehmungen in der Mitte steht. Sie wurde von Plato und seinen Jüngern aufs eifrigste gepflegt. »Kein der Geometrie Unkundiger trete ein!« soll über dem Eingang seiner Akademie gestanden haben. Vom ewig wechselnden Werden zum beständig Seienden führen die »Wecker zum reinen Denken«: die Zahlenkunst (Arithmetik) und Geometrie. Der mathematischen Methode ist auch einer der bis heute wichtigsten Grundbegriffe wissenschaftlichen Denkens entlehnt: derjenige der »Hypothese« , als der Voraussetzung , die das Gesuchte vorläufig als gefunden annimmt, um es sodann durch die aus ihr gezogenen Folgerungen und deren Verknüpfung wirklich zu finden. Auch die Idee ist eben »Hypothesis« , Grundsatz im eigentlichsten Sinne des Worts, selbst unbedingte letzte Voraussetzung und Unterlage des philosophischen Denkens. Die Wissenschaft von den Ideen nennt Plato die Dialektik , weil erst die gemeinsame Erzeugung der Begriffe in der Unterredung (dem »Dialog«) mit anderen zum Reiche der Ideen führt.
Wir müssen weitere schwierige Einzelheiten, wie die Lehre von der Materie, hier übergehen. Desgleichen seine erst in einem seiner spätesten Dialoge entwickelte Naturphilosophie . Sie bildet den schwächsten Teil von Platos philosophischem System, den er selbst gelegentlich als ein geistreiches »Spiel« bezeichnet, und für den er nur Wahrscheinlichkeit, nicht wissenschaftliche Wahrheit in Anspruch nimmt. Die Weltseele , die er hier als eine Art Mittelding zwischen dem Einen und dem Vielen, dem Schaffenden und dem Geschaffenen annimmt, und die den von dem göttlichen Weltbildner erschaffenen Urquell alles Lebens darstellt, hat allerdings genug Unheil von der spätantiken und mittelalterlichen bis zur neueren Philosophie (Schelling) angerichtet.
Gleich ihr ist auch die Einzelseele des Menschen in erster Linie jedenfalls nur Lebensprinzip, die Psychologie also – wie fast bei allen Denkern des Altertums – bloß ein Teil der allgemeinen Naturlehre. Steine werden bewegt; Pflanzen, Tiere und Menschen dagegen bewegen sich selbst, was wir leben nennen. Über die Unsterblichkeit des Einzelnen spricht er sich an verschiedenen Stellen verschieden aus; jedenfalls glaubt er sie nicht mathematisch beweisen zu können. Jener Dreiteilung der Seele in bezug auf das Erkennen (Wahrnehmung, Vorstellung, Idee) entspricht eine ebensolche für die Welt des Willens: das Begehren, das Mutartige oder die Willenskraft, das vernunftgemäße Wollen. Das letztere lenkt als Einsicht, nach dem schönen Gleichnis im Phädrus, das übrige Zweigespann, von dem das edlere Roß (die Willenskraft) das zügellose (die Begierde) bändigen hilft.
Damit stehen wir am Eingang in den dritten und letzten Teil von Platos Philosophie: seiner Ethik . Auch sie findet, gleich der Wissenschaft, ihre Begründung in der Ideenlehre. Die höchste aller Ideen ist die Idee des Guten . Auch sie muß in schwieriger Untersuchung erst gefunden werden. Denn sie ist das Letzte alles Erkennbaren, »mit Mühe nur zu schauen«, »hoch über allem Sein«, dafür auch die Erkenntnis der Wahrheit »an Würde und Kraft« noch überragend. Von allen anderen Ideen, selbst der des Schönen, gibt es Abbilder hienieden; von der des Guten nicht. Sie ist wie die Sonne, die alles Seiende erst erleuchtet und fruchtbar macht; weshalb sie gelegentlich auch mit dem Begriff gleichgesetzt wird, in den der Mensch das Höchste, was er nicht mehr auszudenken, sondern nur noch zu empfinden vermag, zu fassen sucht: der Gottheit . Der Mensch muß sich, wie das wunderbar schöne Gleichnis im siebten Buche des »Staates« ausführt, an ihre »Schau« erst gewöhnen, nachdem er bis dahin, gefesselt an die Höhle des Scheins, bloß Schattenbilder erblickt hat. Und eine zweite »Verwirrung der Augen« überkommt ihn, wenn er dann, noch geblendet von ihrem Glanz, wiederum hinabsteigt zu seinen früheren Mitgefangenen in der Höhle, das heißt der Welt des täglichen Lebens, die, weiter in ihrer Dämmerung dahinlebend, jenen Künder der Idee – wie es ja immer den großen Idealisten und Propheten einer neuen Idee ergangen ist – nicht begreifen, ja als irrsinnig verspotten. Wie bei allen großen Ethikern (Kant, Fichte), wird ferner auch bei Plato das Gute aufs schärfste vom bloß Angenehmen, also auch von der Lust geschieden, für die schon die Tiere als »vollgültige Zeugen« genügen würden. Damit wird die Freude am Natürlichen und Schönen nicht verbannt. Ist doch der Eros, das liebende Verlangen (siehe oben), auch die Wurzel alles künstlerischen Schaffens. Und die Idee des Guten stimmt die Seele zu einer inneren Harmonie, deren Seligkeit aller vergänglichen mit Irrtum und Täuschung gemischten Lust weit überlegen ist.
Aber die Ethik bedarf der Anwendung , der Verwirklichung im Leben des Einzelnen wie der Gesamtheit. Wohl möchte, wer aus der dumpf-dunklen Höhle der Alltäglichkeit zur sonnenbeglänzten Höhe der Idee emporgestiegen, am liebsten stets in ihrem Anschauen verweilen, aber gerade die Idee des Guten treibt ihn wieder hinab zu jenen Armen an Geist, den »Höhlenbewohnern«, um auch sie emporzuführen zum Licht, das sie noch nicht kennen. – Die Tugenden des Einzelnen sind: Besonnenheit oder Selbstbeherrschung , die den begehrlichen Teil des Menschen in Schranken hält, Mannhaftigkeit , die seiner Willenskraft, Einsicht oder Weisheit , die dem vernünftigen Teile der Seele entspricht. Die höchste aber, die drei andern beherrschende Grundtugend ist die der Gerechtigkeit , das Thema seines größten Werkes, der »Republik«. Denn das sittliche Leben des Einzelnen kann sich nur verwirklichen in dem Abbilde des Menschen im großen, dem Staate . Platos Hauptwerk handelt denn auch vom Staat.
In ihm gipfelt seine Philosophie. Die zehn Bücher der Politeia (Staatsverfassung), gewöhnlich mit ihrem lateinischen Namen »Republik« zitiert, enthalten theoretische Philosophie, Ethik, Geschichtsphilosophie, Gesellschaftskritik, Erziehungs- und Staatslehre, alles in einem. Die Grundzüge seiner theoretischen und Moralphilosophie haben wir schon kennengelernt. Beginnen wir also mit seinen geschichtsphilosophischen Ausführungen über Entstehung und Entwicklung des Staates. Denn es steht keineswegs so, daß der große Idealist sein sozialistisches Staatsideal ohne Kenntnis der wirtschaftlichen Grundlagen des Staates und seiner historischen Entwicklung entworfen hätte. Er läßt ihn vielmehr, im zweiten Buche seines Werkes – das erste war allgemeinen Betrachtungen über den Begriff des Gerechten oder Sittlichguten gewidmet –, aus den alltäglichsten Bedürfnissen vor unseren Augen entstehen. Er schildert, wie diese Bedürfnisse dann zu verschiedenen Arten der Technik, zur Arbeitsteilung, zur Warenerzeugung und zum Warenhandel, zur Ausbildung des Geldes als Tauschmittel führten; wie dann infolge von Gebietsstreitigkeiten und Kriegen zu der erwerbenden eine kriegerische und eine regierende Klasse hinzukamen.
Er übt ferner, hauptsächlich im achten Buch seiner Politeia, eine Kritik der zu seiner Zeit bestehenden Gesellschaftsordnung , die an Eindringlichkeit und Schärfe von der sozialistischen Kritik des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts, von Marx bis Trotzky, kaum überboten worden ist. Die Jagd nach dem Gelde ist für einen bedeutenden Teil der Gesellschaft die alleinige Triebfeder des Handelns geworden. Durch die schrankenlose Erwerbsmöglichkeit, wie sie der wirtschaftliche Individualismus gerade dem Willensstarken und Skrupellosen, zumal unter den schon von Haus aus Begüterten bietet, wird der eine Teil der Bevölkerung überreich, der andere sinkt zum Bettlertum hinab. Neben dem »Drohnentum« der Müßiggänger und Verschwender, das den gesellschaftlichen Körper »wie Schleim und Galle« durchseucht, macht sich ein profitgieriges, unbarmherziges Spekulantentum breit, protzenhaft und ungebildet, einzig auf weitere Kapitalanhäufung bedacht; denn der Kapitalismus ist seiner Natur nach unersättlich. Seine Opfer sind mit Schulden überhäuft, ihrer Ehre und jedes Einflusses im Staate beraubt und brüten infolgedessen über Umsturzpläne. Schon bei Plato findet sich das Wort von den » zwei Staaten«, die sich in jedem derartigen Staate feindlich gegenüberstehen: dem der Armen und dem der Reichen. Von dem letzteren (der Plutokratie, der Herrschaft des Reichtums) ist der bestehende Staat immer abhängiger geworden, wie Bebel oder Liebknecht es einmal im Reichstag ausgedrückt hat: die Staatsregierung ist, ob bewußt oder unbewußt, zum »Kommis der besitzenden Klassen geworden«.
Читать дальше