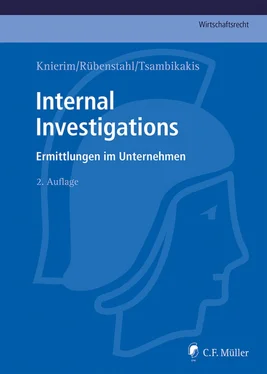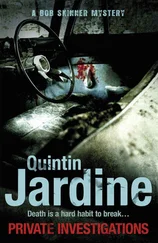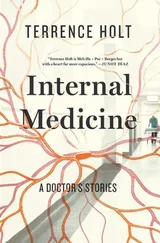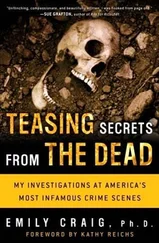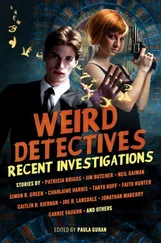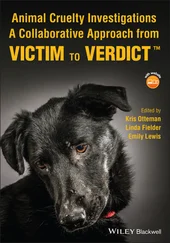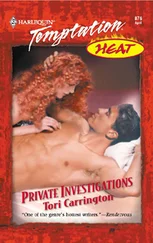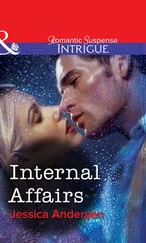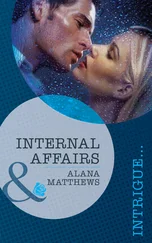aa) Red flags im betrieblichen Finanzwesen
14
Das Institut der Wirtschaftsprüfer („IDW“) zeigt in seinem Prüfungsstandard IDW PS 210 red flags auf, welche insbesondere im Finanzbereich eines Unternehmens auf potentielle Unregelmäßigkeiten oder Gesetzesverstöße hinweisen können. Der Einsatzbereich des IDW PS 210 liegt zwar ursprünglich in der traditionellen Abschlussprüfung, bietet jedoch allgemein verwertbare Anwendungsbeispiele für betriebliche Ermittlungen. Zu den red flags zählen u.a.:[4]
| – |
kritische Unternehmenssituationen, u.a. risikoreiche Ertragsquellen; |
| – |
ungewöhnliche Geschäfte, u.a. Geschäfte mit nahestehenden Personen; |
| – |
nicht protokollierte oder nicht genehmigte Änderungen von computergestützten Informationssystemen. |
bb) Red flags im betrieblichen Einkauf
15
Die Weltbank hat für die betriebliche Funktion Einkauf die „Most Common Red Flags of Fraud and Corruption in Procurement“[5] erhoben. Die red flags stellen die, aus Sicht der Weltbank, zehn häufigsten Standardfälle und Warnzeichen von möglichen Unregelmäßigkeiten in Einkaufsprozessen dar. Bspw. werden ungewöhnliche Bietermuster und hiermit zusammenhängende mögliche Absprachen durch folgende Indizien operationalisiert:
| – |
die Höhe der abgegebenen Gebote unterscheidet sich systematisch anhand verschiedener linearer Abweichungen zueinander (bspw. 1 %, 10 % Abweichungen); |
| – |
die abgegebenen Gebote stehen in einem auffälligen Missverhältnis zueinander und sind entweder zu hoch oder zu niedrig; |
| – |
Verlierer von Angebotsverfahren werden Zulieferer der Gewinner der Angebotsverfahren; |
| – |
offensichtliche Rotation von Gewinnern von Angebotsverfahren. |
cc) Projektspezifische Entwicklung von Indikatoren
16
Die aus Literatur und Praxis bekannten red-flags können als theoretische Benchmarks im Sinne objektivierter Erfahrungswerte eine erste Orientierung in der Planung des Prüfungsprogramms geben und potentielle Risiken sowie praktische Ermittlungsschritte aufzeigen. Im Einzelfall sind diese Indikatoren grundsätzlich individuell auf den Arbeitsauftrag und die Komplexität des Einzelfalls anzupassen, weiterzuentwickeln und unter Berücksichtigung der Prüfungsziele zu gewichten.
17
Ein möglicher Ausgangspunkt der Entwicklung von Risikoindikatoren kann hierbei das sog. „Self-Assessment“ des betroffenen Unternehmens sein. Im Mittelpunkt steht hier zunächst die in der Eigenverantwortung des Unternehmens stehende Analyse und Auswertung von Problembereichen.
18
Die erarbeiteten Indikatoren sollen im Ergebnis zu einem erkenntnisrelevanten Risikoprofil führen, welches möglichst offen zu konzipieren ist, um auch vergleichbare Muster und Fälle zu erfassen, die eventuell noch nicht bekannt sind.[6] Ein Vorteil solcher red flag Systeme zeigt sich in der Analyse von standardisierten Massendaten. Wenn es gelingt, aus dem identifizierten Risikoprofil ein quantitatives Indikatormodell zu entwickeln und dieses handhabbar in die Arbeitsphase, u.a. der Datenanalyse und –auswertung, einzubringen, lässt sich eine hohe Datendichte mit relativ einfachen und standardisierten Mitteln effektiv untersuchen. Voraussetzung hierfür ist die Ableitung valider Indikatoren, wie bspw. atypische Merkmalshäufungen oder das Vorliegen eindeutiger Hinweiskombinationen.
19
Beispiel:
Ermittlungen im Kontext von Vertriebsunregelmäßigkeiten in einem Unternehmen führen zu einem möglichen Risikoprofil mit den folgenden red flags, die in der Phase der Informationsbeschaffung abgefragt werden sollen:
| – |
„Zahlungen an Lieferanten mit Sitz in Steueroasen“; |
| – |
„Phantasienamen von Kunden mit ungewöhnlicher Rechtsform“; |
| – |
„Sitz des Zahlungsempfängers weicht vom Bankland ab“; |
| – |
„Zahlung ohne erkennbaren Leistungsgegenstand bzw. Bestellung“. |
20
Art und Umfang von Prüfungshandlungen werden, abgesehen von einer Vollprüfung von Geschäftsvorfällen, durch das risikoorientierte Prüfungsprogramm bemessen. Grundsätzlich ist es sinnvoll, je Prüffeld einen Mindestprüfungskatalog zu planen, der in späteren Ermittlungsphasen neuen Erkenntnissen angepasst werden kann. Bei der Bestimmung des Umfangs von Prüfungshandlungen sind Stichprobenverfahren anzuwenden, um valide Prüfungsaussagen, bezogen auf die gewählte Stichprobengröße und Grundgesamtheit zu gewährleisten und insgesamt eine hohe Prüfsicherheit zu erreichen.
21
Begleitend zur Bestimmung der Prüfungshandlungen sind insbesondere der Einsatz von Ermittlungstools und Prüfungstechniken sowie die Art der Dokumentation und, soweit erforderlich, des Reportings zu planen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, welche Arten von Informationsquellen im Unternehmen verfügbar sind und welche Zugänge sowie Verwertungsmöglichkeiten hierzu bestehen, da u.a. datenschutzrechtliche Bestimmungen die Verwertung von Informationen erheblich erschweren können.[7]
22
Hinsichtlich der personellen Planung liegt der wesentliche Schwerpunkt in der Zusammenstellung und Sicherstellung der Verfügbarkeit der für die Ermittlung erforderlichen Wissensressourcen. Dabei sind die Berücksichtigung ausreichender fachlicher Qualifikationen und beruflicher Erfahrungen Mindestvoraussetzungen bei der Planung. Abhängig von Art, Umfang und Komplexität des Ermittlungsauftrags kann die Personalplanung von der einfachen Einsatzplanung eines oder mehrerer Spezialisten bis hin zur Bildung von multidisziplinären Ermittlerteams reichen. Insbesondere ist der Grundsatz der Unabhängigkeit zu beachten, nach dem die am Ermittlungsprozess beteiligten Personen keine Interessenskonflikte, u.a. finanzielle oder persönliche, in Hinblick auf das Untersuchungsobjekt haben dürfen. Geeignete Maßnahmen zur Sicherung der Unabhängigkeit sind bei der Personalplanung im Vorfeld der eigentlichen Ermittlungstätigkeit zu berücksichtigen.
23
Eine sinnvolle Planungsdimension ist bei Überschreitung einer kritischen Auftragsgröße die Einbindung unternehmensinterner Spezialisten und Managementkapazitäten, die als Knowhow-Träger, Türöffner und Wegweiser im untersuchten Unternehmen fungieren können.
24
Weiterhin sind in Abhängigkeit vom Detailgrad der Planung verschiedene Aspekte vor der Untersuchung zu organisieren, um insbesondere die Ermittlerteams bei der Beweissicherung in den Unternehmensbereichen in einer Kurzschulung zu informieren. Hierzu gehören u.a.:
| – |
der Umfang der Befugnisse der Ermittler; |
| – |
die während der Ermittlungen einzusetzenden Methoden der Datenanalyse und Datenauswertung; |
| – |
die Anforderungen an das interne und externe Reporting; |
| – |
zeitliche Restriktionen hinsichtlich der Prüffelder und Abgabe- sowie Berichtstermine. |
[1]
Da der Schwerpunkt auf der sachlichen Planung liegt, wird auf die separate Darstellung der zeitlichen Planungsaspekte verzichtet. Soweit erforderlich, wird auf die zeitliche Planung an anderer Stelle eingegangen. Zur ausführlichen Darstellung des Planungsprozesses vgl. 4. Kap. Rn. 87 ff.
[2]
IDW PS 240, Rn. 19.
[3]
Ansätze für weitere betriebliche Funktionen und Branchen wurden bspw. vom OECD ( www.oecd.org/governance/procurement/toolbox/indicatorsofprocurementrisk.htm) oder dem State of New York ( http://apipa2010.pitiviti.org/files/fraud_redflats.pdf) vorgestellt.
Читать дальше