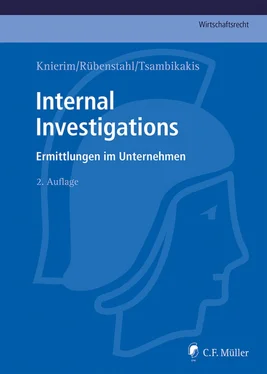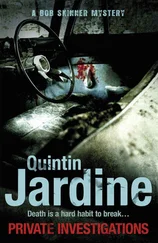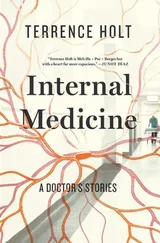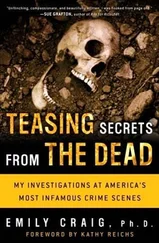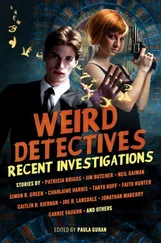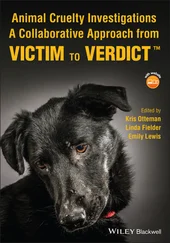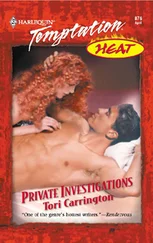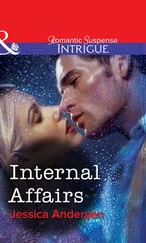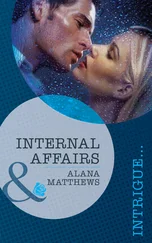1. Teil Ermittlungen im Unternehmen› 6. Kapitel Ermittlungen und Beweissicherung – Unterlagen und EDV› I. Einleitung
1
Die in den letzten Jahren bekannt gewordenen Korruptionsgeschäfte bei Siemens, Daimler oder MAN sowie die aktuellen technischen Manipulationen bei Volkswagen, gehörten zu den wohl größten deutschen Wirtschaftsskandalen in jüngster Zeit und führten in den betroffenen Unternehmen zu zeitlich intensiven, teilweise jahrelangen Ermittlungen. Diese auch in den Medien viel diskutierten Fälle bilden lediglich die Spitze des Eisbergs der tagtäglichen praktischen Ermittlungsvielfalt, die sich von einfachen oder personenbezogenen Untersuchungsthemen bis hin zu juristisch, betriebswirtschaftlich und technisch komplexen Ermittlungssachverhalten in internationalen Unternehmen erstrecken.
2
Im vorliegenden Beitrag werden exemplarische Schwierigkeiten, punktuelle Denkanstöße und mögliche Lösungsansätze aus der Ermittlungspraxis in Unternehmen aus der Sicht externer Ermittler dargestellt. Hierzu wird im ersten Abschnitt kurz auf Planungsaspekte des Ermittlungsprozesses[1] eingegangen. Der zweite Abschnitt und Hauptteil beinhaltet die Darstellung wesentlicher Meilensteine eines praktischen Ermittlungsprozesses. Insbesondere wird der Hauptteil punktuell um aktuelle IT-Themen ergänzt. Abschließend werden im dritten Abschnitt kurz die Anforderungen an die Dokumentation von Ermittlungsaktivitäten erläutert.
[1]
Die Begriffe Ermittlung, Prüfung und Untersuchung werden in diesem Beitrag vereinfachend im gleichen Kontext verwendet.
1. Teil Ermittlungen im Unternehmen› 6. Kapitel Ermittlungen und Beweissicherung – Unterlagen und EDV› II. Prüfungsplanung
3
Die Prüfungsplanung ist ein Bestandteil der Auftrags- und Projektplanung und setzt sich im Wesentlichen aus der sachlichen Planung der Ermittlungsziele und des Prüfungsprogramms sowie der personellen und zeitlichen Planung zusammen.[1]
1. Sachliche Planung
a) Definition von Ermittlungszielen
4
Die Definition der Ermittlungs- oder auch Prüfungsziele ist der wesentliche Ausgangspunkt der Prüfungsplanung und bestimmt im Folgenden die Konzeptionierung des Prüfungsprogramms zur Operationalisierung von Untersuchungsschwerpunkten. Die zunächst trivial erscheinende Definition von Ermittlungszielen wird oftmals durch die praktische Komplexität und den Facettenreichtum des Einzelfalls erschwert. Das Ermittlungsziel geht in der Regel unmittelbar aus dem mehr oder weniger konkreten Arbeitsauftrag hervor. Im Verlauf der Untersuchungen werden regelmäßig weitere Risiken identifiziert, welche in der Anfangsphase der Ermittlungen zunächst nicht im Fokus standen.
5
War es bspw. im Falle Siemens zunächst die einfache Anfrage eines Betriebsprüfers zum wirtschaftlichen Gehalt von Zahlungen an Auslandslieferanten, weiteten sich im Laufe der Zeit die Ermittlungen wie ein Flächenbrand auf weitere rechtliche und betriebswirtschaftliche Gebiete aus. Immer weitere Ermittlungsziele resultierten aus Anforderungen unterschiedlicher Interessengruppen und bezogen sich u.a. auf Themen der Korruption, Steuerhinterziehung, Untreue, Geldwäsche, US-Börsengesetze sowie auch auf arbeitsrechtliche Fragestellungen.
6
Bei Vorliegen mehrerer Ermittlungsziele besteht die Notwendigkeit zur Erarbeitung einer nach Prioritäten abgestuften Zielhierarchie, welche unterschiedliche Ziele und Zieldimensionen bündelt und gewichtet.
b) Risikoorientiertes Prüfungsprogramm
7
Die in der ersten Planungsphase erarbeiteten Ermittlungsziele werden in ein risikoorientiertes Prüfungsprogramm überführt, in welchem die Identifizierung und Analyse problem- bzw. risikobehafteter Unternehmensprozesse und Verhaltensmuster im Mittelpunkt stehen. Der Kerngedanke des risikoorientierten Prüfungsprogramms ist die Erarbeitung eines Bündels von Prüfungshandlungen, mit denen unter Berücksichtigung einer vertretbaren Wesentlichkeit das angestrebte Ermittlungsziel zunächst möglichst ökonomisch umgesetzt werden kann.
8
Der risikoorientierte Prüfungsansatz steht gerade bei der Prüfung gesetzeswidriger Sachverhalte im Spannungsfeld zwischen einer idealen Vollprüfung und einer möglichst ökonomischen Aufarbeitung von Sachverhalten. Ein Gesetzesverstoß ist in der Regel nicht an die Intensität des Gesetzesbruchs geknüpft, so dass bspw. die Höhe von Korruptionszahlungen, mit Ausnahme von Bagatellfällen, für die Einordnung eines Straftatbestands rechtlich unerheblich ist. Jedoch ist auf der ersten Stufe der Planungs- und Ermittlungsaktivitäten eine Komplexitätsreduktion durch eine risikoorientierte Vorgehensweise in Abstimmung mit öffentlichen Ermittlern, wie bspw. der Staatsanwaltschaft oder steuerlichen Außenprüfern, üblich. Trivial verkürzt bedeutet dies bspw. im Falle von vermuteten Korruptionsgeschäften, dass zunächst internationale Großprojekte mit relativ hohen Vermittlungsprovisionen – ab einer mit mathematisch-statistischen Verfahren ermittelten Beitragsgrenze – geprüft würden.
9
Das Prüfungsprogramm wird hierzu in einzelne Untersuchungsgebiete, die sog. Prüffelder[2], aufgeteilt. Innerhalb der Prüffelder sind auf Grund der ersten Risikoeinschätzungen Prüfungsschwerpunkte zu bestimmen, um hieraus konkrete operationale Merkmale oder Indikatoren abzuleiten, die zunächst Gegenstand der Untersuchung sind. Den Prüffeldern werden Ermittlungshandlungen zugewiesen, deren Art und Umfang sich individuell je nach Risikogewichtung im Sinne eines Mindestprüfungskatalogs bemessen.
10
Beispiel:
Es werden Vermögensschädigungen eines Unternehmens durch die Geschäftsführung vermutet. Das Prüfungsziel besteht zunächst in der Analyse sämtlicher Transaktionen zwischen Geschäftsführung und Unternehmen. Hierauf aufbauend kann die sinnvolle Einteilung von Prüffeldern in die folgenden Untersuchungsgebiete sinnvoll sein:
| – |
Geschäftsvorfälle, z.B. Verträge, zwischen dem Unternehmen und der Geschäftsführung oder der Geschäftsführung nahestehender Unternehmen oder Personen, wie bspw. Familienmitglieder; |
| – |
Banktransaktionen und Kassenbewegungen; |
| – |
Geschäftsvorfälle mit offensichtlich negativen Auswirkungen auf das Vermögen des Unternehmens wie bspw. der zu günstige Verkauf von Vermögensgegenständen; |
| – |
Bewirtungs-, Spesen- und Reisekostenabrechnungen zur Beurteilung der Abrechnung von Privatkosten oder der Angemessenheit von Aufwendungen. |
11
Der Risiko- und Prüfungsschwerpunkt wird in der Praxis auf dem ersten Prüfungsfeld, den Transaktionen zwischen dem Unternehmen und der Geschäftsführung sowie dieser nahestehenden Unternehmen liegen. Das vorgenannte Prüfungsfeld bietet in der Regel den höchsten Verschleierungsgrad und das geringste Entdeckungsrisiko mit den „lukrativsten“ Einnahmemöglichkeiten des Schädigenden, ist jedoch von Art und Umfang der Prüfungshandlungen relativ arbeitsintensiv.
12
Zur Operationalisierung von Prüfungszielen und Abgrenzung von Prüfungsfeldern können in diesem Fall Indikatorsysteme mittels sog. „red flags“ herangezogen werden. Red flags sind Anzeichen, Indizien oder auch Warnhinweise, die auf Straftaten, andere Gesetzesverstöße oder betriebliche Unregelmäßigkeiten hinweisen können.
13
Zahlreiche typisierte red-flag-Modelle für verschiedene betriebliche Funktionen und Branchen resultieren aus Umfragen, Erfahrungswerten und empirischen Beobachtungen aus der Ermittlungspraxis. Diese Modelle zeigen potentielle Anzeichen für Straftaten, ordnungswidrige Handlungen oder sonstige Unregelmäßigkeiten an und können erste Ansatzpunkte für die Ermittlungsplanung aufzeigen. Exemplarisch werden im Folgenden red flags für die betrieblichen Funktionen Finanzen und Einkauf erläutert.[3]
Читать дальше