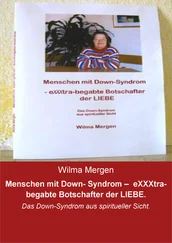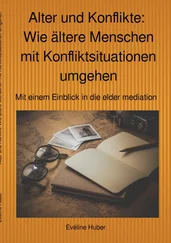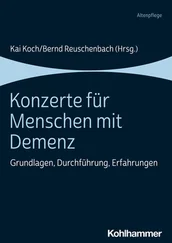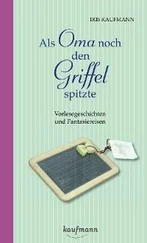Keeley C (2015) Qualitative Forschung mit Menschen mit geistiger Behinderung. Notwendigkeit und methodische Möglichkeiten zur Erhebung subjektiver Sichtweisen unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung, ZHeilpädagog, 66, S. 108–119
Kuckartz U (2014) Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. 2., durchgesehene Aufl. Weinheim, Basel: Beltz
8Die Transkription erfolgte nach den Transkriptionsregeln nach Kuckartz (2014) und die Auswertung mit Hilfe der Software MAXQDAVersion 12 (  Anlage 1).
Anlage 1).
Teil II Theoretische Hintergründe
4 Anmerkungen zur Kontextualisierung von Komplexer Behinderung
Tobias Bernasconi und Ursula Böing
In den vielen unterschiedlichen Begriffen, die für die Beschreibung und Benennung von Menschen mit Behinderung genutzt werden, spiegeln sich die Vorstellungen und Deutungen eines gesellschaftlich-kulturellen Gedächtnisses und eines in diesem Kontext geführten Diskurses wider. Die Feststellung einer Behinderung ist insofern immer an die Beobachtungsmöglichkeit einer Gesellschaft und den mit diesen Beobachtungen verbundenen Subjektivierungsprozessen geknüpft (Fritzsche 2018; Weisser 2005, S. 22). Kulturhistorisch betrachtet war und ist Behinderung dabei eingelagert in einen gesellschaftlichen Diskurs um Fähigkeiten und Erwartungen (Buchner et al. 2015; Merl 2019; Weisser 2005) und somit eine »Erfahrung […], die sich aus Konflikten zwischen Fähigkeiten und Erwartungen ergibt« (Weisser 2005, S. 16). Als »behindert« werden dann Personen bezeichnet, die den Erwartungen der Beobachtenden nicht entsprechen und deren Fähigkeiten aus dieser Beobachtungsperspektive heraus als »Nicht-Können« (Merl 2019) markiert werden.
Auch Bezeichnungen für Personen, die unter der Bedingung veränderter neuronaler und anderer körperlicher Strukturen und – sich möglicherweise kumulierender – unterschiedlicher Funktionsbeeinträchtigungen leben, werden aus dieser Beobachterperspektive heraus getroffen. Behinderung kann hier durch die Hinzuziehung weitere Adjektive zu einer »schweren« bzw. »schwersten« bzw. »mehrfachen« Behinderung oder wahlweise – in einer Kombination dieser Adjektive – zu einer »Schwerstmehrfachbehinderung« werden. In anderen, jüngeren Kontextualisierungen wird – wie in dieser Veröffentlichung – z. B. von »Komplexer Behinderung« (Fornefeld 2008a), von »hohem oder komplexem Unterstützungsbedarf« (Dieckmann et al. 2016) oder von »intensiver Behinderungserfahrung« (Schuppener 2011) gesprochen.
Der Begriff »Menschen mit Komplexer Behinderung« wurde von Fornefeld (2008b) mit der Intention in den Diskurs eingeführt, die Exklusionstendenzen und die »systembedingten Kontextfaktoren« (Fornefeld 2008b, S. 51) hervorzuheben, unter denen der so bezeichnete Personenkreis lebe. »Komplex« sei dabei nicht als Adjektiv zur Beschreibung von »Behinderung« zu verstehen, sondern diene als »Attribut der Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung« (Fornefeld 2008b, S. 51).
Schuppener (2011) setzt unter Rückgriff auf das soziale Modell von Behinderung den Begriff der »intensiven Behinderungserfahrungen« (Schuppener 2011, S. 300) und beschreibt dies als »hohe[s] Risiko des Erlebens von Stigmatisierung und Exklusion« (Schuppener 2011, S. 300), denen der so bezeichnete Personenkreis ausgesetzt sei. Intensive Behinderungserfahrungen implizierten ein ständiges Risiko des »Nicht-verstanden-werdens« (Schuppener 2011, S. 301) und seien als »Lebensbewältigungskompetenz« (Schuppener 2011, S. 301) anzusehen.
Mit dem Begriff des hohen oder komplexen Unterstützungsbedarfes (Dieckmann et al. 2016; Weber 2016) wird der beobachtende Blick auf die Unterstützungsbedürftigkeit von Personen aufgrund unterschiedlicher Beeinträchtigungen im Kontext ihrer Lebenslage gerichtet. Unterstützung umfasse dabei »nicht nur die direkte Begleitung und Beratung einer Person im Alltag, sondern auch die Organisation der gesamten Lebensführung zusammen mit dem sozialen Netzwerk der Person« (Dieckmann et al. 2016, S. 62). Mit diesem Begriff soll insofern betont werden, dass der so bezeichnete Personenkreis nur mit ganzheitlicher Perspektive in der Verwobenheit individueller Bedürfnisse und Bedarfe und der damit einhergehenden prekären Lebenslage betrachtet werden kann. In dieser Perspektive zeigt sich auch, dass Teilhabe kein abstrakt-allgemeiner Zustand ist, sondern gleichsam als Kontinuum gesehen werden kann, dessen Pole Abhängigkeit auf der einen und weitgehende Möglichkeiten zur Selbstbestimmung auf der anderen Seite darstellen. Dabei gilt: Je abhängiger eine Person ist, desto wichtiger ist der Kontext bzw. sind positive unterstützende Kontextbedingungen zur Ermöglichung von Teilhabe. Gleichsam verweist dies auf die Verantwortung der unterstützenden Fachkräfte, von denen Sensibilität und Reflexivität einzufordern sind (Bernasconi 2022).
Neben den genannten Begriffen und den damit verbundenen Konnotationen existieren in Theorie und Praxis durchaus noch weitere Setzungen. Im Folgenden soll es jedoch weniger darum gehen, den Personenkreis definitorisch ein- oder abzugrenzen, indem vorhandene Begrifflichkeiten auf ihren terminologischen Gehalt hin überprüft oder gegeneinander abgewogen werden. Vielmehr ist intendiert, die diskursive Funktion dieser Begriffssetzungen in den Blick zu nehmen, um sich den zugrundeliegenden »Wahrnehmungs- und Wissenspraxen im Feld der Behinderung« (Weisser 2005, S. 8) anzunähern. Bezogen auf den Prozess der Benennung erscheinen die in verschiedenen Kontexten hervorgebrachten und genutzten Begriffe an sich weder »richtig« noch »falsch«, vielmehr entfalten sie ihre spezielle Konnotation erst im Zusammenhang mit den ihnen zugrundeliegenden Praktiken, sodass entscheidender der kritisch-analytische Blick auf eben diese Kontexte weiterhilft (Behrisch 2016, S. 3).
Die existierenden Begriffe sind folglich weniger als Beschreibung einer bestimmten Person oder eines Personenkreises zu sehen, sondern sie offenbaren vor allem Zuschreibungen aus der Beobachterperspektive. In Zuschreibungsprozessen können bestimmte Merkmale einer Person vom Beobachtenden als irritierend, fremd, möglicherweise bedrohlich oder ängstigend wahrgenommen werden (Weisser 2005, S. 37 ff.). Dies sind in der Regel keine abstrakten Merkmale, wie z. B. »Intelligenz« oder »Autonomie« bzw. die unterstellte Abwesenheit selbiger, sondern sehr konkrete, auf eine einzelne Person bezogene, beobachtbare »körperlich manifeste Abweichungen« (Weisser 2005, S. 36 f.), die sich im performativen, handlungspraktischen Vollzug, z. B. durch Bewegungen und Positionierungen im Raum, kommunikative Abläufe oder lautliche Äußerungen, darstellen und die die Erwartungen der Beobachtenden irritieren und »Abwehrstrategien« (Weisser 2005, S. 37 ff.) erzeugen. Beobachtenden Personen erscheint im handlungspraktischen Vollzug etwas konkret Beobachtbares als z. B. »schwerstbehindert« und wird in der Folge jemandem zugeschrieben. Performativ beobachtbare Unterschiede zwischen den Erwartungen der Beobachtenden werden so zu verallgemeinerten Merkmalen einer Person und in der Folge durch die Bündelung von Beobachtungen und Erfahrungen zur Definition eines Personenkreises. In sozialen Interaktionsprozessen werden diese Merkmale in der Folge unter einen Begriff subsummiert. Dieser Prozess der Kategorisierung führt zu einer Verdinglichung der so bezeichneten Personen (Weisser 2005, S. 36). Praxeologisch betrachtet handelt es sich bei diesen Kategorisierungsprozessen um Prozesse des »doing [profound, Anm. d. V.] disability« (Köbsell 2016, S. 89), um kulturelle Differenzkonstruktionen zur Markierung einer sozialen Zugehörigkeit, die als konjunktives, atheoretisches Wissen in gesellschaftliche Strukturen und Prozesse eingelagert sind. Kulturelle Differenzkonstruktionen verweisen dabei keinesfalls auf soziale Tatbestände oder naturgegebene Realitäten, sondern auf »soziale Praktiken der Herstellung von Situationen, von Identitäten und von Institutionen« (Tervooren & Pfaff 2018, S. 36) und auf die handlungspraktischen Bedingungen der Zuschreibung von Behinderung.
Читать дальше
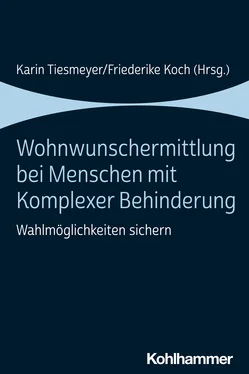
 Anlage 1).
Anlage 1).