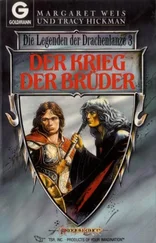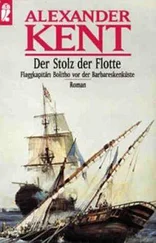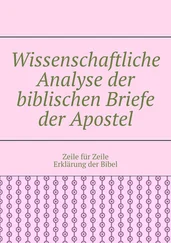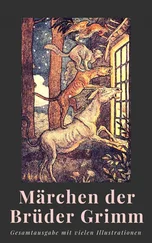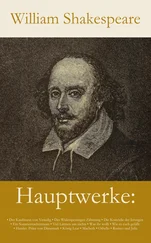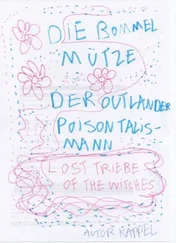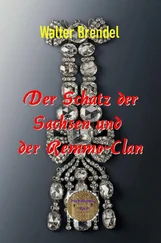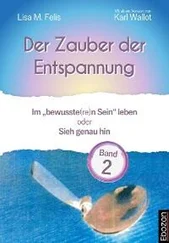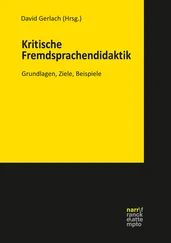Zugleich war es unser Ziel, ein in sich geschlossenes, kohärentes Handbuch vorzulegen, dessen Kapitel miteinander verschränkt sind und aufeinander Bezug nehmen und das auf einer von uns allen geteilten Vorstellung von Forschung in der Fremdsprachendidaktik basiert. Dieses gemeinsame Forschungsverständnis haben wir Herausgeber*innen uns in häufigen intensiven Diskussionen und breiten Recherchen über etwa fünf Jahre hinweg bis zum Erscheinen der ersten Auflage erarbeitet. Und wir haben diesen intensiven Diskurs bei der Arbeit an der zweiten Auflage fortgesetzt. Jedes Kapitel, das von einer/m von uns verfasst ist, wurde in allen Fassungen von allen gelesen, einer kritischen Analyse unterworfen, kommentiert, ergänzt und ausführlich besprochen. Insofern ist dieses Handbuch auch in all den Teilen, für die eine/r der vier Herausgeber*innen namentlich genannt ist, dennoch in vielerlei Hinsicht ein Gemeinschaftswerk.
Das heißt jedoch nicht, dass unser Ziel der Vereinheitlichung und Abstimmung immer bis in die Formulierungen hineinwirkt. Aufmerksame Leser*innen werden feststellen, dass sich durchaus noch unterschiedliche Schreibstile, verschiedene und unterschiedlich konsequente Arten des gendergerechten Schreibens und Variationen in der Verweisdichte ergeben haben.
Auch für die Konzeption und Struktur des Handbuches zeichnen wir – Daniela Caspari, Friederike Klippel, Michael K. Legutke, Karen Schramm – gemeinsam verantwortlich. Am Anfang stand die Idee eines Handbuchs, das die Situation der deutschen fremdsprachendidaktischen Forschung und insbesondere Kontexte und Erfordernisse der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses berücksichtigt. Der Erfolg der ersten Auflage bestätigt unseren Optimismus, ein diesbezüglich nützliches Handbuch geschrieben zu haben.
Es ist unser Anliegen, das Handbuch auf dem neuesten Stand zu halten. Darunter verstehen wir zum Ersten eine Aktualisierung der in der ersten Auflage enthaltenen Kapitel im Hinblick auf neue Erkenntnisse und Entwicklungen, auf die benutzte Literatur oder die Einbeziehung zusätzlicher Referenzarbeiten, zum Zweiten aber auch eine Erweiterung des Spektrums der Forschungsverfahren, die in den letzten Jahren eine stärkere Berücksichtigung erfahren haben. So enthält die zweite Auflage im zentralen Kapitel 5 zwei neue Unterkapitel, und zwar zur Dokumentarischen Methode (s. Kap. 5.3.4) und zu Test- und Fragebogenstatistik (s. Kap. 5.3.12). Zudem wurden mehrere Grafiken überarbeitet, Passagen in allen Kapiteln aktualisiert oder modifiziert und Literaturhinweise ausgetauscht oder ergänzt. Allerdings war es durch die Schließung der Bibliotheken während der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 nicht in allen Fällen möglich, Zitate mit eventuellen Neuauflagen der betreffenden Werke abzugleichen oder neu erschienene Publikationen einzusehen.
Wir danken zahlreichen Kolleg*innen aus der Wissenschaft, unseren Doktorand*innen und Habilitand*innen sowie vielen kritischen Leser*innen für konstruktive und ermutigende Rückmeldungen zur ersten Auflage. Diese haben uns motiviert und bei der Überarbeitung geleitet.
Daniela Caspari
Friederike Klippel
Michael K. Legutke
Karen Schramm
› Literatur
Gnutzmann, Claus/Königs, Frank/Küster, Lutz (2011). Fremdsprachenunterricht und seine Erforschung. Ein subjektiver Blick auf 40 Jahre Forschungsgeschichte und auf aktuelle Forschungstendenzen in Deutschland. In: Fremdsprachen Lehren und Lernen 40, 1–28.
2. Grundfragen fremdsprachendidaktischer Forschung
Daniela Caspari
2.1 Was ist Forschung? Welches sind zentrale Forschungsentscheidungen?
Diese grundlegende Frage wird in den bisher erschienenen deutschsprachigen Handbüchern bzw. Einführungen in die fremdsprachendidaktischen Forschungsmethoden nicht thematisiert. Obwohl auch im Rahmen dieses Handbuches keine grundlegende Abhandlung möglich ist, erscheint es gerade in Hinblick auf die Zielgruppe Forschungsnoviz*innen sinnvoll, sich die Unterschiede zwischen Beobachtungen im Alltag oder in der beruflichen Praxis einerseits, so wie sie z.B. von angehenden Lehrperonen im Praktikum oder Referendariat verlangt werden, und der wissenschaftlichen Erforschung von Fragestellungen andererseits bewusst zu machen. Diese Unterschiede sind eher gradueller als grundsätzlicher Natur, wie z.B. an der Geschichte der Fremdsprachenforschung (s. Kap. 3.1), an forschungsmethodischen Ansätzen wie der Aktionsforschung (s. Kap. 4.2) oder bestimmten Verfahren zur Datengewinnung (s. z.B. Kap. 5.2.3 und 5.2.4) zu erkennen ist. Denn es scheint in der Natur des Menschen zu liegen, Phänomenen in seiner Umwelt auf den Grund zu gehen, nach Gesetzmäßigkeiten zu suchen sowie auf der Basis von Beobachtungen und Erfahrungen Theorien aufzustellen und Vorhersagen zu machen. Während dies im Alltag in der Regel eher zufällig, unbewusst und ad hoc geschieht, zumeist um konkrete Herausforderungen und Probleme des täglichen Lebens zu meistern, zeichnet sich wissenschaftliche Forschung durch eine systematische, regelgeleitete und methodisch kontrollierte Herangehensweise aus.
Sie ist gleich in zweifacher Hinsicht systematisch: zum einen bezüglich der untersuchten Phänomene (hier gilt es, gründlich zu suchen und alles zu berücksichtigen, was man findet, und nicht nur das, was zur eigenen Vorstellung passt), zum anderen bezüglich der Forschungsschritte und Forschungsverfahren. Das schließt nicht aus, dass Forschung auch durch beiläufiges Finden angeregt werden kann, das dann ein gezieltes Weiter-Suchen auslöst (zum Wechselspiel zwischen Suchen und Finden vgl. Schlömerkemper 2010: 11–13). Der Forschungsprozess folgt etablierten Regeln, die beständig reflektiert und kontrolliert werden, die Ergebnisse sind intersubjektiv nachvollziehbar bzw. überprüfbar und falsifizierbar. Ein wesentliches Merkmal besteht darin, dass die Ergebnisse auf der Basis von bzw. in Zusammenhang mit bereits vorhandenem wissenschaftlichen Wissen entstehen und diskursiv verhandelbar bzw. korrigierbar sind. Daher ist es erforderlich, dass die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung veröffentlicht bzw. allgemein zugänglich gemacht werden.
Bei wissenschaftlicher Forschung handelt es sich um einen Prozess, der von den Forscher*innen beständig Entscheidungen verlangt: von der Wahl des Forschungsgegenstandes (Thema), über die Forschungsfrage/n, den Forschungszugang, die Erhebungs- und Auswertungsverfahren bis hin zu Art und Ort der Veröffentlichung der Ergebnisse. Es ist unabdingbar, diese Entscheidungen bewusst und in Kenntnis ihrer Bedingungen und Auswirkungen zu treffen, daher sind sie Gegenstand dieses Kapitels.
Grundlegend für die Wahl des Forschungszugangs sind die jeweiligen Annahmen über die Beschaffenheit der sozialen Wirklichkeit und die Möglichkeiten ihrer Erforschung. Unterschieden werden auf einer Makroebene daher ein subjektivistischerForschungszugangsubjektivistischer und ein objektivistischerForschungszugangobjektivistischer ForschungszugangForschungszugang ( subjectivist approach vs. objectivist approach ; vgl. im Folgenden Cohen/Manion/Morrison 2018: 5–8), die sich u.a. in ihrer Auffassung von der Natur des Menschen und der Wirklichkeit unterscheiden. Mit diesen unterschiedlichen Forschungszugängen gehen Annahmen darüber einher, was und wie man etwas herausfinden und dies anderen mitteilen kann: Kann ich soziale Wirklichkeit von außen, d. h. durch Beobachtung wahrnehmen und erklären, ihre Gesetzmäßigkeiten erkennen und daraus Voraussagen über zukünftiges Verhalten ableiten? Diese Auffassung legt einen etischetischen Zugang zum Forschungsfeld nahe, in dem von außen Kategorien an einen Untersuchungsgegenstand angelegt werden. Oder muss ich Menschen bzw. spezifischen Gruppen von Menschen und ihren Referenzsystemen möglichst nahekommen, damit ich, soweit dies überhaupt möglich ist, ihre Innensicht auf sich selbst und ihr soziales Umfeld nachzeichnen kann? Diese Auffassung legt einen emischemischen Zugang zum Forschungsfeld nahe, der von den kultur- und sprachspezifischen Kategorien der Forschungspartner*innen ausgeht.
Читать дальше