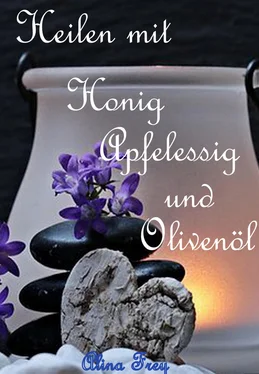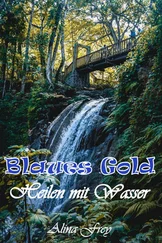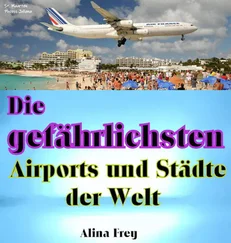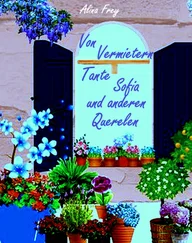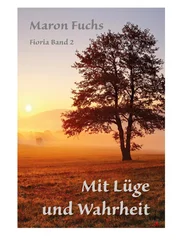Obwohl in hochwertigen Honigsorten bis zu 245 natürliche Inhaltsstoffe nachgewiesen wurden, besteht Honig dennoch zu 80 Prozent aus reinem Zucker. Die durchschnittliche Zusammensetzung eines Honigs sieht wie folgt aus: * 38 Prozent Fructose * 31 Prozent Glucose * 10 Prozent Mehrfachzucker * 17 Prozent Wasser * je nach Sorte ca. 2 bis 4 Prozent Aminosäuren, Vitamine, Mineralstoffe, Enzyme, organische Säuren und sekundäre Pflanzenstoffe * Das Fructose – Glucose – Verhältnis bestimmt die Konsistenz des Honigs. Da Glucose im Honig schneller kristallisiert als Fructose, ist Honig mit einem hohen Glucose - Anteil cremig bis fest, während ein Honig mit weniger Glucose und höherem Fructose - Gehalt eher flüssig ist. Doch wie entsteht eigentlich Honig und welche gesundheitlichen Vorteile bringt er mit sich?
Honigbienen produzieren ihren Honig zum überwiegenden Teil aus dem zuckerhaltigen Pflanzensaft von Blütenpflanzen, dem Nektar. Über ihren langen Saugrüssel gelangt der Nektar zunächst in die Speiseröhre und anschließend in den Honigmagen (Honigblase), wo er gesammelt wird. Einen kleinen Teil ihres Ertrags nutzen die Bienen zur Energiegewinnung für ihren anstrengenden Rückflug zum Bienenstock. Den Rest ihrer „Beute“ überlässt die fleißige Sammlerin dann ihren Stockgenossinnen. Neben dem Nektar sammeln Bienen auch Honigtau, der von Laub – oder Nadelbäumen stammt. Auf diesen Bäumen halten sich verstärkt Schild – und Blattläuse auf, die mit ihren scharfen Mundwerkzeugen die Nadeln anstechen, um den Zellsaft auszusaugen. Die darin enthaltenen Aminosäuren sind das Lebenselixier der Läuse, doch den Zucker, den sie ebenfalls mit dem Saft aufnehmen, benötigen sie nicht. Daher scheiden sie ihn zum größten Teil wieder aus. Davon profitieren jene Bienen, die im Wald nach Nahrung suchen. Sie saugen ihn auf und bringen ihn heim. Die Stockgenossinnen nehmen die Ernte der Sammlerin in Empfang. Dabei reichen sie diese von Biene zu Biene weiter, während jede dieser Bienen den Nektar oder Tau über ihren Speichel mit körpereigenen Enzymen vermengt. In der Folge dieser Weitergabe steigt der Enzymgehalt des unreifen Honigs enorm an. Ein Teil dieser Enzyme spaltet die Kohlenhydrate auf, wodurch sich auch die Zuckerzusammensetzung verändert. Zudem verdunstet durch die ständige Bewegung in der warmen Stockluft das überschüssige Wasser, so dass der noch unreife Honig langsam eindickt. Er wird von den Bienen sorgfältig auf die
Waben verteilt und erst am Ende eines hochkomplexen Reifungsprozesses kann der Imker mit der Honigernte beginnen.

Honig – die Nahrung der Bienen
Natürlich hofft jeder Imker auf eine gute Ernte, doch eine solche ist nicht nur für ihn wichtig. Vor allem die Bienen sind auf ausreichende Honigvorräte angewiesen, denn Honig stellt die Nahrungsgrundlage für sie und ihre Brut dar. Anders als Wespen und Hummeln, von denen lediglich die Königinnen den Winter überleben, versuchen die Bienen auch in der kalten Jahreszeit ihr ganzes Volk am Leben zu halten. Und um das zu erreichen, müssen sie derart viel Wärme produzieren, dass selbst bei Außentemperaturen von minus 20 Celsius im Bienenstock die erforderliche Mindesttemperatur von 30 Celsius bestehen bleibt. Das kostet den Bienen enorm viel Energie, doch dank angemessener Honigvorräte können sie diesen Energieverlust immer wieder ausgleichen. So benötigt ein Bienenvolk für die Überwinterung in Mitteleuropa etwa 25 Kilogramm Honig. Wenn die Bienen in den warmen Monaten genügend Nektar oder Honigtau sammeln konnten, produzieren sie weit über 100 Kilogramm Honig. Ermittelt man nun den ganzjährigen Honigbedarf eines Bienenvolkes, inklusive der Überwinterung, so bleiben in der Regel immer noch einige Kilogramm Honig für den Imker übrig. Nun liegt die Entscheidung alleine beim Imker, ob lediglich der verbliebene Honig in den Verkauf gelangt oder ob den Bienen darüber hinaus ein Teil ihrer Nahrung genommen und durch die Zufütterung von Zuckerwasser ersetzt wird. Bei der industriellen Honiggewinnung wird generell maximaler Profit angestrebt, daher ist hier die Verwendung von Zuckerwasser gang und gäbe. Regionale Imker hingegen
nutzen häufig beide Varianten, während Bio – Imker weitestgehend auf eine Zufütterung verzichten.
In der konventionellen Imkerei wird aus Profitgründen zu ähnlichen Maßnahmen gegriffen, wie sie bereits aus anderen konventionellen Tierzuchtbetrieben hinlänglich bekannt sind. Die Betriebe unterliegen nur wenigen gesetzlichen Verordnungen und werden auch nur äußerst selten kontrolliert. Daher können auch in der Bienenzucht durchaus chemotherapeutische Medikamente zum Einsatz kommen, die künstliche Befruchtung der Königinnen ist erlaubt und auch deren Flügel dürfen beschnitten werden. All diese Praktiken sind in der konventionellen Bienenzucht möglich. In der Bio – Imkerei sind derartige Methoden strikt verboten. Kommt es in einem Bio – Imkerbetrieb tatsächlich einmal zu Erkrankungen der Bienen, wie z.B. zum Varroamilben – Befall, werden ausschließlich organische Säuren zur Behandlung eingesetzt. Die gesetzlichen Vorgaben für Biobetriebe sind umfangreich und unterliegen regelmäßigen, strengen Kontrollen.
Ganz gleich, ob du den Honig innerlich einnehmen oder äußerlich anwenden möchtest – Honig sollte immer von bestmöglicher Reinheit und Qualität sein. Kaufe daher: * keinen Honig in Plastikbehältnissen, denn die darin enthaltenen Weichmacher finden sich letztlich auch im Honig wieder. * Billig – Honig, denn Qualität hat immer ihren Preis. * Import – Honig, denn er wurde in der Regel pasteurisiert (auf mindestens 75 Celsius erhitzt) und enthält häufig genmanipulierte Pollen. Eine Ausnahme stellt hier der Manuka – Honig aus Neuseeland dar. * konventionell hergestellten Honig, denn hier dürfen diverse Gifte zur Verhinderung von Krankheit zum Einsatz kommen, die auch auf den Honig übergehen können. In Deutschland und in der Schweiz vergibt der jeweilige Imkerbund ein Siegel, das nur auf Honiggläsern mit inländischem und unbehandeltem Honig aufgebracht werden darf. Ein Honig mit dem Siegel grenzt sich deutlich von einem Importhonig ab und weist auf gewisse Qualitätsstandards hin. So wurde dieser Honig nach der Ernte weder erhitzt noch wurden ihm Stoffe hinzugefügt oder entzogen. Bio – Imker unterliegen besonders strengen Richtlinien und das Einhalten derselben wird regelmäßig überprüft. So kannst du beim Bio – Honig sicher sein, dass die hohen Qualitätsstandards auch tatsächlich eingehalten werden. Ein Auszug aus den Richtlinien eines Bio – Betriebs: * Das Beschneiden der Flügel der Königin ist
verboten. * Die Verwendung chemischer Medikamente und Pestizide ist verboten. * Im Umkreis von drei Kilometern dürfen im Wesentlichen nur Pflanzen des ökologischen Anbaus und / oder Wildpflanzen stehen. Es dürfen sich dort weder Autobahnen, noch Müllverbrennungsanlagen oder andere schadstoffausstoßende Betriebe befinden. * Der Standort muss über genügend natürliche Quellen für Nektar, Honigtau und Pollen verfügen sowie über einen Zugang zu Wasser. * Die Bienen werden ausschließlich in Bienenkästen aus natürlichen Rohstoffen gehalten. Für den äußeren Anstrich müssen schadstofffreie Farben verwendet werden. * Eine eventuell erforderliche Zufütterung im Winter findet mit eigenem Honig oder Pollen statt. Nur in Ausnahmefällen darf Bio – Zuckersirup verwendet werden. * Zur Honiggewinnung werden nur unbebrütete, rückstandsfreie Waben verwendet. * Der Honig wird zu keiner Zeit über 40 Celsius erhitzt. *
Читать дальше