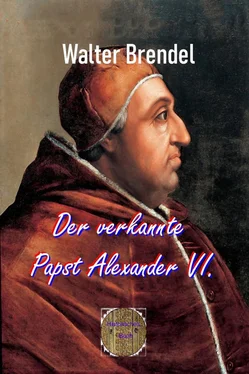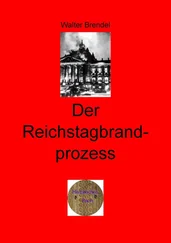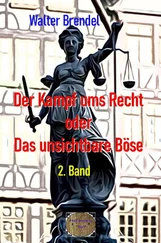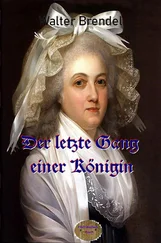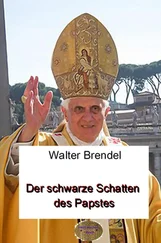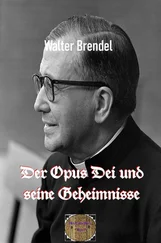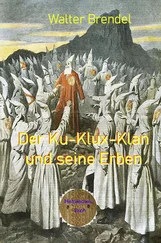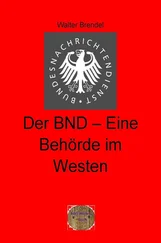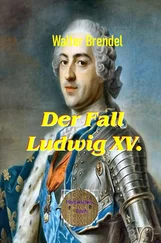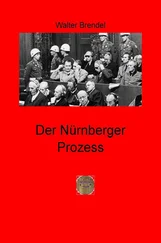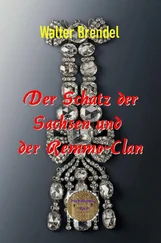Rodrigo Borgia kannte die schmutzige Praxis, seit ihn sein Onkel, Papst Calixt III., 1457 zum päpstlichen Vizekanzler bestallt hatte.
Das Amt, das Rodrigo antrat, war in Bedrängnis, ein weitgehend politischer Posten, der ein Reich verteidigen musste. Frankreichs König Karl VIII. marschierte in Italien ein, am Silvestertag 1494 stand er in der Ewigen Stadt. Der Papst musste in der Engelsburg Schutz suchen.
Doch wie so oft hatte Alexander den längeren Atem: Mit einer „Heiligen Allianz“ europäischer Verbündeter konnte er den Eindringling schließlich ganz zurückschlagen.
Doch die Macht und die Gebiete, die er gewann, nutzte er vor allem zur Bereicherung seiner Familie: „All sein Trachten richtet sich darauf, seinen Söhnen Staaten zu verschaffen“, lautete das Urteil des Venezianers Donato. Seinen eigenen Sohn Cesare hatte er schon zum Kardinal gemacht, als der gerade 17 Jahre alt und noch nicht einmal zum Priester geweiht war. Insgesamt 16 Bischofstitel häufte Cesare an; doch ließ er sich bald von seinen Kirchenämtern befreien, um sich ganz der Kriegsführung widmen zu können.
Seine Schwester Lucrezia, auch sie illegitimes Kind der Lieblingsmätresse Vanozza, wurde unterdessen wie ein Kapital aus dem Familienvermögen hin- und her investiert in immer neue Hochzeiten, stets maximal gewinnbringend; die alten Ehemänner ließ mutmaßlich Cesare mit Hilfe von Würgeschlingen beseitigen.
Dass Kirchenfürsten Kinder mit Geliebten zeugten, war in der Epoche normal, nicht jedoch, dass sie die illegitimen Sprösslinge als leibliche Nachfahren anerkannten. Das tat Alexander bei mindestens sieben Kindern.
Lucrezia soll er vergöttert haben. Die selbstbewusste junge Frau, die im Kloster viele Fremdsprachen, auch Latein und Griechisch, studiert hatte, forderte die Kirchenwelt heraus. In einer Zeit, in der gebildete Frauen als Hexen verbrannt wurden, ging sie im Vatikan ein und aus, verkehrte ganz selbstverständlich mit den höchsten geistlichen Würdenträgern, wurde vom Vater in seiner Abwesenheit sogar einmal als Stellvertreterin eingesetzt.
Das musste provozieren.
Lucrezia Borgia wurde zur Femme fatale. In späteren Jahrhunderten, vor allem durch die französische Romantik, war sie die Giftmischerin, der männermordenden Salome gleich. Ihr Vater, dessen Appetit nach Frauen legendär war, soll mit ihr Inzest getrieben, sogar ein Kind gezeugt haben.
Reinhardt hält das für „abwegig“: Alexander habe genug willige Gespielinnen gehabt, die Blutschande hätte sein Image verheerend geschädigt. Schriftsteller wie Dumas, Ludwig Huna oder Victor Hugo, auch der Komponist Gaetano Donizetti sorgten dafür, dass der düstere Borgia-Mythos weiterlebte, obwohl Lucrezia sich als spätere Herzogin von Ferrara mit Krankenfürsorge, der Kunstförderung und großem Geschäftssinn als Einzige der Familie ein ehrbares Ansehen erwarb.
Während sie dämonisiert wurde, erntete ihr brutaler Bruder Cesare, der sogar die Ermordung seines Bruders Giovanni veranlasst haben soll, Lob; der Renaissance-Philosoph und Diplomat Niccolò Machiavelli hebt ihn in seinem berühmten Werk „Der Fürst“ als „Vorbild“ eines machtbewussten Herrschers heraus. Noch Friedrich Nietzsche feierte um 1880 Cesare als einen „Virtuosen des Lebens“, ihm gefiel dessen Ruchlosigkeit wider die christliche Moral.
Manche hielten gar den Sohn für den eigentlichen Spiritus Rector von Alexanders Pontifikat. Falsch, meint Reinhardt, der Papst habe ganz klar die Fäden in der Hand gehabt, Vater und Sohn hätten vielmehr eine perfekte Rollenteilung betrieben mit Cesare als Mann fürs Grobe. Er führte das Terrorregime in Rom und der Romagna, mit dem die Familie den alten Feudaladel von seinem Besitz verdrängte. Vater und Sohn ließen auch den venezianischen Kardinal Giovanni Michiel vergiften, um sich dessen Besitztümer anzueignen. Der Fall erregte ein solches Aufsehen, dass der nachfolgende Papst Julius II. 1504 dazu einen Kriminalprozess anstrengte.
Zorn und Hass auf die Borgia wuchsen, doch nur wenige trauten sich, öffentlich gegen die mächtige Familie aufzutreten.
Es brauchte erst einen Girolamo Savonarola, jenes berühmten, aber auch berüchtigten Bußpredigers aus Florenz, der zum Märtyrer werden sollte. Er wird heute verklärt dargestellt, doch am Ende wollte er auch nur eines: Macht.
Alexander ließ den Mönch exkommunizieren. Doch auch die Machtkämpfe um das von Savonarola damals beherrschte Florenz führten dazu, dass der Eiferer ins Gefängnis geworfen, gefoltert und schließlich am 23. Mai 1498 öffentlich hingerichtet wurde.
In all den Wirren und Skandalen führte einer akribisch Buch: der deutsche Zeremonienmeister des Papstes, Johannes Burckard, ein prinzipientreuer Traditionalist. In seinem Tagebuch notierte er alles, was im Vatikan und auch außerhalb vor sich ging.
Es kam nie zum offenen Bruch, aber begann sich der Chronist so für die Nachwelt zu distanzieren vom Skandal-Papst? Immerhin kopierte Burckard auch einen anonymen Brief, angeblich aus einem spanischen Heerlager an einen italienischen Edlen gesandt, in dem der Heilige Vater als „Verräter der Menschheit“, „Feind Gottes, Belagerer des Glaubens Christi und Unterwühler der Religion“ angeprangert wird; alles sei „beim Papste käuflich: Würden, Ehren, Ehebünde und -scheidungen“.
Der wohl fiktive Brief datiert vom 15. November 1501.
Da neigt sich Alexanders Pontifikat schon dem Ende zu. Der Papst stirbt im August 1503 überraschend nach plötzlichem Unwohlsein am Fieber.
Die Macht der Borgia stürzt nun wie ein Kartenhaus zusammen. Cesare landet später in einem spanischen Kerker, kann fliehen und stirbt 1507 schließlich bei einem Kampf.
Bei aller Wut, die nun gegen die Borgia losschlug: Von der Kurie wurde Alexanders Amtszeit hinter vorgehaltener Hand als durchaus erfolgreich bewertet.
Als Herrscher des Kirchenstaates hatte er sich ja durchaus klug gezeigt, das politische Gleichgewicht in Italien zwischen Frankreich und Spanien zu erhalten versucht, urteilen etwa August Franzen und Remigius Bäumer in ihrer Papstgeschichte. Für die Kirche allerdings, so ihre Bilanz, war sein Pontifikat dennoch „ein Unglück“.
Noch sein Tod löste wilde Gerüchte aus: War er womöglich selbst Opfer einer Vergiftung geworden? Hatten er und sein Sohn versehentlich aus Pokalen getrunken, die eigentlich für ihre Feinde bestimmt waren? Die Forschung hält längst auch eine profanere Ursache für möglich: Malaria.
Der Rest ist Legende.
Die Kritik an dem landläufigen Geschichtsbild von den verbrecherischen und sittenlosen Borgia, das etwa Alexander VI., um nochmals Stendhal zu zitieren, als die gelungenste Inkarnation des Teufels auf Erden erscheinen lässt, beschränkt sich nicht etwa auf den Versuch, lediglich einen Teil der gegen die Borgia erhobenen Vorwürfe zu entkräften oder zu mildern.
Sie versucht vielmehr nachzuweisen, dass dieses Geschichtsbild in seiner Gesamtheit mit den historischen Tatsachen nicht vereinbar ist und die Borgia das Opfer einer Legendenbildung geworden sind. So vertritt etwa Susanne Schüller-Piroli in einem 1963 erschienenen Werk mit dem Titel „Borgia. Die Zerstörung einer Legende“ die Auffassung, dass das Bild der Borgia im Laufe der Zeit eine regelrechte Dämonisierung erfahren hat.
Dies ist freilich nur eine von vielen Kritiken an dem herkömmlichen Borgia-Bild. Schon der den Päpsten sicher keine übermäßige Sympathie entgegenbringende Voltaire hat sich über die Verteufelung der Borgia lustig gemacht. Der große katholische Historiker der Päpste, Ludwig von Pastor, distanzierte sich von dem ausschließlich negativen Borgia-Bild ebenso wie der liberale Ferdinand Gregorovius, der nach einem eingehenden Quellenstudium in seiner Biografie über Lucrezia Borgia nachwies, dass diese sicher nicht das giftmörderische Ungeheuer war, als das sie vielfach dargestellt worden ist. Allerdings sieht auch das Bild, welches Pastor und Gregorovius von den Borgia zeichnen, immer noch wenig vorteilhaft aus. Die wohlwollendsten Beurteilungen der Borgia findet man häufig bei protestantischen, angelsächsischen Historikern. Es seien hier nur die Namen von Roscoe, Creighton, einem anglikanischen Bischof, und Garnett genannt. Nicht zu Unrecht meint daher Will Durant in seiner „Kulturgeschichte der Menschheit“ etwas skeptisch, dass sich das Urteil dieser Autoren über die Borgia durch große Milde auszeichne. Sein eigenes Urteil über die Borgia unterscheidet sich dann allerdings von dem der eben genannten Autoren wenig. Die wohl leidenschaftlichste Verteidigung der Borgia findet sich in dem fünfbändigen Werk des Paters Peter de Roo „Material for a History of Pope Alexander VI“.
Читать дальше