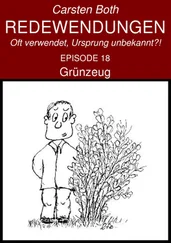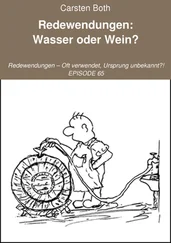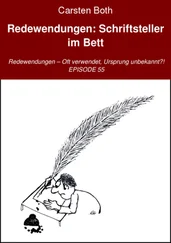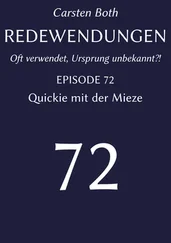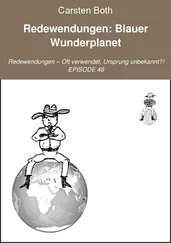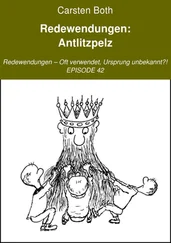cboth 0499ep14v0
Beginnen wir mit einer äußerst beliebten Redewendung, hinter der sich auch noch eine schöne Geschichte aus den Anfängen wissenschaftlicher Forschung verbirgt: Das ist der Springende Punkt. Die nette Wendung hat ihren Ursprung im alten Griechenland und geht auf eine Naturbeobachtung des griechischen Philosophen Aristoteles (384-322 v.Chr.) zurück. Damals waren die Wissenschaftler noch Universalgelehrte, die sich für alles interessierten, und nicht – wie heute – vornehmlich totale Fachidioten. Aristoteles beobachtete ein frisch bebrütetes Vogelei und sah einen kleinen sich bewegenden Blutfleck im Eiweiß, der nach seiner Interpretation nichts anderes als das künftige Vogelherz sein konnte. Die lateinische Übersetzung dieser wissenschaftlichen Entdeckung machte aus dem bereits lebendigen Minivogelherzen in der ersten Entwicklungsphase ein „punctum saliens“. Die deutsche Übersetzung lautete „hüpfender“ oder „springender Punkt“ – und schon war die Grundlage einer schönen Redewendung gelegt. Über die Interpretation als der „Punkt, von dem das Leben ausgeht“ kam man zum „entscheidenden, wichtigsten Punkt“ bis zur heutigen zentralen Bedeutung des Springenden Punktes als Betitelung des Ausschlaggebenden und Entscheidenden eines bestimmten Sachverhalts. Der von Aristoteles in seiner „Geschichte der Tiere“ („Historia animalium“) gemutmaßte Hüpfpunkt wurde im Deutschen wohl Anfang des 19. Jahrhunderts redensartlich gängig. Als früher Nachweis gilt der dritte Band des Romans „Titan“ (1802) von Jean Paul (1763-1825). Zum heute ausschließlich springenden ist der Punkt vermutlich erst allmählich in der zweiten Jahrhunderthälfte geworden, obwohl sich der Buchrezensent Karl August Varnhagen von Ense (1785-1858) schon 1827 über dessen mehrfache Unsichtbarkeit beschwert hatte: „Verworren in oberflächlicher, nicht in tiefer Verwirrung, ohne Hervortreten des Eigenthümlichen (…) zieht der gewaltige Stoff träge vorüber; kein Vorgang erscheint in seiner bestimmten Eigenheit, nirgends werden die springenden Punkte sichtbar, kein Ereigniß wird deutlich, keines tritt in seiner Nothwendigkeit hervor, ...“ In der sicherlich lesenswerteren Erzählung „Vom alten Proteus“ (1875) ignorierte Wilhelm Raabe (1831-1910) den Springpunkt noch: „… so wollen wir nun dem Hüpf-, Brüt- und Lebenspunkt im Ei dieser Historie näher gehen.“ Dafür ließ Friedrich Spielhagen (1829-1911) in seinem Roman „Sturmflut“ (1877) gleich nach mehreren fragen: „Welches aber sind die springenden Punkte unsres Jahrhunderts?“ – um an dessen Ende per Novelle „Herrin“ (1899) noch zu erläutern: „Und nun kommen wir zu dem punctum saliens. (…) Der springende Punkt; das, worauf es eigentlich ankommt.“
Zur Erläuterung der nächsten Wendung ein kleiner medizinischer Exkurs: Neuralgie ist einfach gesagt ein Nervenschmerz, etwas genauer gesagt ein Schmerz, der auf das Ausbreitungsgebiet eines Nervs beschränkt ist. Ein neuralgischer Punkt weist folglich eine Körperstelle aus, die besonders schmerzempfindlich ist. Im übertragenen Sinne wird das Adjektiv neuralgisch als „kritisch“ oder „sehr problematisch“ verwendet. Als Redewendung steht der Neuralgische Punktsomit für eine bestimmte Stelle, an der es immer wieder zu Problemen kommt. Der aus den griechischen Begriffen „neuron“ (= Nerv) und „algos“ (= Schmerz) gebildete Medizinbegriff kam erst im 20. Jahrhundert redensartlich für allerlei weitere Schwachpunkte zum Einsatz. Als feste Fügung sollte der Neuralgische Punkt wie der zuvor besprochene Springende durchaus mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben werden, selbst wenn dies die gelehrte Standardsprache (bislang) nicht vorsieht.
Wenn ich übrigens an Ärzte und das absurde Abrechnungssystem für ihre Leistungen denke und mir so manche aktuelle Schlagzeile vergegenwärtige ( Abrechnungsbetrug, weil Arzt neuesten Mercedes kaufen mußte! ), so liegt die Vermutung nahe, daß sich bei einigen golfspielenden „Halbgöttern in Weiß“ so mancher dunkle Punktaufspüren ließe. Die Redewendung deutet auf gewisse moralisch nicht einwandfreie Begebenheiten (nicht nur) in der Vergangenheit hin. Der dunkle Punkt geht vermutlich auf die altertümliche Vorstellung zurück, daß die menschliche Seele dunkle Flecken bekommt, falls man etwas Unrechtes tut. Da sollte sich diesbezüglich so mancher Arzt vielleicht mal heimlich selber röntgen! Sie können auch einmal versuchen, mit einem praktizierenden Mediziner über gewisse Mißbrauchstatbestände bei der Abrechnung zu diskutieren. Bei einigen Exemplaren werden Sie schnell zu spüren bekommen, daß Sie damit wohl einen wunden Punktangesprochen haben. Ein wunder Punkt ist ein Bereich, in dem eine Person sehr anfällig und empfindlich ist und auch meist genauso reagiert, wenn ein entsprechender Tatbestand zur Sprache kommt. In der deutschen Literatur sind Hinweise auf wunde Punkte von Personen und (in) Organisationen in der Biedermeierzeit (1815-48) gebräuchlich geworden, entsprechende auf dunkle vermutlich erst ab der Jahrhundertmitte.
Medizin und Ableben haben oft miteinander zu tun, wie auch der Präsident der Bundesärztekammer mit seinem glorreichen Reformvorschlag des „sozialverträglichen Frühablebens“ hervorgehoben hat. Und schon sind wir bei der nächsten Redewendung, dem toten Punkt, der gleich zwei Bedeutungen haben kann: Der tote Punkt kann für ein bestimmtes Stadium stehen, in dem keine Fortschritte mehr erzielt werden (können). Dementsprechend könnte eine Schlagzeile lauten: Die Verhandlungen zur Gesundheitsreform haben einen toten Punkt erreicht. Darüber hinaus steht der tote Punkt für einen Zustand stärkster Erschöpfung, der vor allem beim Langstreckenlauf früher oder später – je nach der körperlichen Konstitution des Masochisten – unweigerlich erreicht wird. Diesen gilt es zu überwinden, und dann sind die restlichen 30 km des Marathonlaufs (so zumindest die Theorie) auch kein Problem mehr. Der Ursprung dieser Wendung ist in der Technik zu suchen: Dort wird nämlich der Zustand eines mechanischen Antriebs, bei dem die Pleuelstange und die Kurbel eine gerade Linie bilden, toter Punkt genannt. In dieser Lage geht es weder vor noch zurück, denn die Pleuelstange kehrt just an dieser Stelle ihre Bewegungsrichtung um. Der irgendwie oder eben nicht zu überwindende Totpunkt wird vermutlich seit Mitte des 19. Jahrhunderts in diesem übertragenen Sinne redensartlich verwendet. Carl Jentsch (1833-1917) schrieb in „Weder Kommunismus noch Kapitalismus“ (1893): „… Berlin freilich hat den toten Punkt überwunden, seitdem es, durch politische Verhältnisse begünstigt, Millionenstadt geworden ist, ...“ In der Erzählung „Die Brücke über die Ennobucht“, die Max Eyth (1836-1906) in seinem Ingenieurs-Taschenbuch „Hinter Pflug und Schraubstock“ (1899) unter der Überschrift „Berufstragik“ veröffentlichte, half dabei im Jahr 1876 Verwandtschaft: „aber dank dem nicht zu bändigenden Willen meines unglaublichen Schwiegervaters ist der tote Punkt überwunden, ...“ In Friedrich Spielhagens Novelle „Herrin“ (1899) scheiterte dies geistig: „Da war er wieder an dem toten Punkt, über den seine grollenden Gedanken nicht weg konnten!“ Standardsprachlich werden auch die Adjektive dieser drei redensartlichen Punkte bis heute klein gehalten, was insbesondere beim verschiedenen und düsteren kritisch zu hinterfragen ist; solche idiomatischen Ausdrücke sollte man per Großschreibung kenntlich machen (dürfen), schon um Mißverständnisse zu vermeiden.
Читать дальше