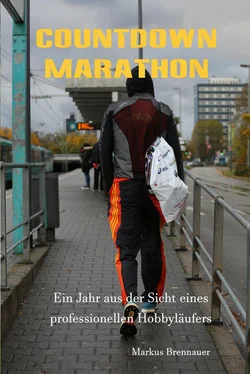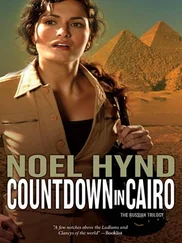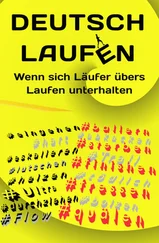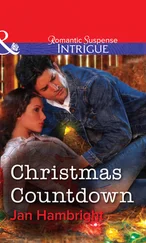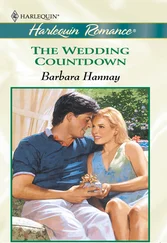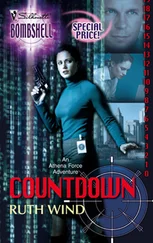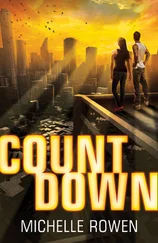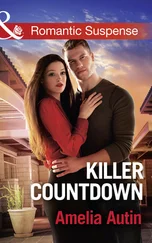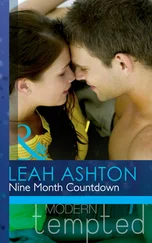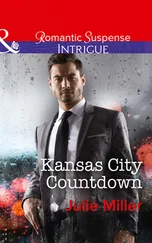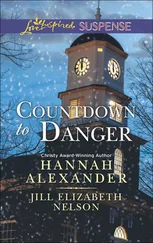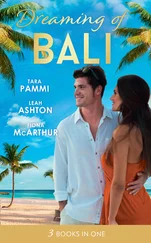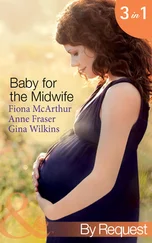Auf der ersten Hälfte eines Berglaufs denke ich mir immer, dass das Tempo „voll langsam“ ist und ich dieses Mal ganz vorne landen kann. Doch spätestens ab der Halbzeit merke ich, dass meine Beine nicht mehr können und ich langsamer und langsamer werde, obwohl ich regelmäßig Höhenmeter in meine Dauerläufe einbaue. Bei meinem letzten Berglaufversuch am Blomberg bei Bad Tölz hatte ich sage und schreibe vier Minuten Rückstand auf den Sieger bei gerade einmal 20 Minuten Laufzeit verloren. Dass der Sieger Toni Lautenbacher kurz darauf deutscher Berglaufmeister wurde, bei der Berglauf-WM als bester Deutscher trotz Seitenstechens Platz 16 belegte und zur Weltklasse im Skibergsteigen gehört, mag man vielleicht als Entschuldigung akzeptieren. Allerdings verliere ich auf Toni, der im Nachbarort wohnt, über 10 km gerade einmal eine Minute. Das ist aber nur eine grobe Schätzung, da Toni sehr wahrscheinlich bei einem Laufwettkampf im Flachen noch nie an sein Limit gehen musste, was vor allem seinen Lauftrainer ärgert, der gerne einmal wissen möchte, was sein Schützling wirklich zu leisten imstande wäre.
Der Sixtus-Lauf Schliersee wäre für mich eine mehr als geeignete Möglichkeit, in der Extremwertung eine hohe Punktzahl zu erreichen, denn über die Halbmarathon-Distanz bin ich relativ gesehen deutlich schneller unterwegs als über 10 km oder andere kürzere Distanzen. Diese Tatsache wird dadurch untermauert, dass meine 10-km-Bestzeit eine Durchgangszeit ist. Damals, bei den deutschen Halbmarathonmeisterschaften 2016 in Bad Liebenzell, durchlief ich die 10-km-Marke nach 32:39 Minuten (falls die Kilometerschilder auf der Strecke stimmten), was neun Sekunden schneller war als meine offizielle 10-km-Bestzeit. Wenn ich in Schliersee in Topform wäre, könnte ich sehr viele Punkte für die Gesamtwertung der Oberland Challenge sammeln. Zudem müsste mir die Tatsache entgegen kommen, dass der Schlierseelauf kein reiner Straßenlauf ist, sondern eine Mischung aus Trail-, Wald- und Straßenlauf. Ich liebe es, wenn es hin und wieder bergauf und bergab geht, über Wurzeln, unebenes Gelände und verschiedene Untergründe. Dabei muss ich kaum mein Tempo reduzieren, ganz im Gegensatz zu vielen anderen Läufern, die nicht ganz so trittsicher sind wie ich. Obwohl ich, wie oben erwähnt, bislang nie an einem Traillauf teilgenommen hatte, hatte ich schon jede Menge Erfahrung mit verschiedenen Laufuntergründen sammeln können.
Die Aussage „ich habe noch nie an einem Traillauf teilgenommen“ ist allerdings nicht ganz richtig. Korrekt wäre: „Ich habe noch nie an einem Wettkampf teilgenommen, der sich selbst als Trail bezeichnet.“ Der Begriff „Trail“ kam in den vergangenen Jahren immer mehr in Mode, doch eigentlich gibt es Trailläufe schon seit ich denken kann, doch hießen diese entweder Crossläufe, Waldläufe oder verrieten mit ihrem Namen allenfalls den Ort der Veranstaltung, nicht aber den Untergrund. Mittlerweile ist man dazu übergegangen, die Läufe mit der Zusatzbezeichnung „Trail“ zu kennzeichnen, um die Laufgemeinde darauf hinzuweisen, dass der Lauf bergauf und bergab über Stock und Stein führt und nicht eben nur über Asphalt. Dabei sind streng genommen die meisten Berg-, Wald- und Crossläufe ebenfalls Trailläufe, doch vor allem die Begriffe Waldlauf und Crosslauf sind mittlerweile etwas aus der Mode gekommen und haben einen angestaubten Charakter. (Aus diesem Grund haben wir vom TSV Penzberg auch unseren 2015 zum ersten Mal durchgeführten Lauf „Team-Trail“ genannt und nicht „Team-Crosslauf“). Bereits 1989 hatte ich bei einem „Traillauf“ teilgenommen, dem Benediktbeurer Kirtalauf, der über Kieswege und sogenannte „Single Trails“ führt, und auch heute (bei fast identischer Streckenführung) nach wie vor so heißt wie damals. Seit Anfang der 1990er bin ich auch regelmäßiger Gast bei diversen Crosslaufmeisterschaften. Ich liebe Crossläufe, denn hier kann man auch einmal Läufer, gegen die man auf der Straße oder auf der Bahn keine Chance hat, nicht nur ärgern, sondern eventuell sogar bezwingen. Da ich sie so schätze und ich diese als unerlässlich in der Saisonvorbereitung für das Frühjahr bzw. den Sommer erachte, habe ich in den vergangenen Jahren die ganze Entwicklung zum Thema „Trailrunning“ einerseits etwas belächelt, andererseits aber mit Freude verfolgt. Denn bei uns im Leistungssport gehörte Trailrunning schon immer dazu, sei es im Training oder im Wettkampf, wir nannten es nur nicht so.
Ich muss gestehen, ich habe Läufe, die den Namen „Trail“ in sich tragen, sozusagen boykottiert. Trailläufe hatten in den vergangenen Jahren immer Zuwächse bei den Teilnehmern, während traditionelle Crossläufe teilweise mit rückgängigen Teilnehmerzahlen zu kämpfen hatten. Natürlich liegt dies daran, dass die Veranstalter der Trailläufe die breite Schar der Hobbyläufer für sich gewinnen konnten, da sie ihnen Abenteuer und neue Herausforderungen versprachen. Die Crosslaufveranstalter sprachen hingegen oftmals nur der Klientel der Leistungsläufer an, deren Zahl (und Leistungsfähigkeit) sich im Vergleich zu den 1980ern und 1990ern deutlich verringert hatte. Mittlerweile hatte ich den Trend akzeptiert und war sogar etwas neugierig darauf geworden. Der Lauf am Schliersee kam mir also gleich in doppelter Weise entgegen: einmal, so hoffte ich, als wertvoller Punktelieferant für die Oberland Challenge, zum anderen als erste Erfahrung und als hochqualitatives Training für die mögliche Teilnahme an der Traillauf-WM.
Gigathlon – Mountainbike-Marathon ohne Mountainbike
Trailläufe an sich sollten für mich, als erfahrenen Crossläufer, keinerlei Problem darstellen. Doch die Distanz lag deutlich außerhalb meiner bisherigen Komfortzone, um nicht zu sagen, die Distanz von 50 Kilometer war quasi Lichtjahre von meinen bisherigen Wettkampfdistanzen entfernt. Trotzdem traute ich mir so eine Distanz ohne Weiteres zu. Ich war sogar überzeugt davon, dass ich einigermaßen konkurrenzfähig sein müsste, das entsprechende Training vorausgesetzt. Um zu verstehen, woher diese Zuversicht stammt, muss ich einerseits zwölf Jahre zurück in die Vergangenheit blicken, andererseits einfach meine Trainingserfahrungen in den vergangenen zwei, drei Jahren beschreiben. 2004 wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass mein Körper wohl etwas anders funktioniert als bei den anderen Menschen (vielleicht haben andere Menschen diese Fähigkeit ebenfalls, trauen sich aber nicht, an ihre Grenzen zu gehen).
„Wir brauchen jemanden, der für unser Team beim Gigathlon in der Schweiz Anfang Juli startet.“ So startete die verhängnisvolle Unterhaltung mit Peter Maisenbacher Mitte Juni 2004. Vielen ist Peter als Moderator bei diversen Läufen wohlbekannt, sei es beim Berlin Marathon, beim München Marathon oder bei zahlreichen anderen Veranstaltungen, natürlich vor allem im Bayern. Aber auch als Autor, der mit seinen Kolumnen und Artikeln in diversen Laufzeitschriften nicht nur sein Fachwissen mit den Leserinnen und Lesern teilt, sondern auf oft unterhaltsame Art das Thema „Laufen“ von allen Seiten beleuchtet, hat er sich in der Läufergemeinde einen Namen gemacht. Damals arbeitete ich für Peter. Wir führten zahlreiche Laktat-Leistungsdiagnostiken durch, erstellten Trainingspläne, leiteten Laufkurse, erstellten Broschüren zum Thema „Laufen“ für Krankenkassen und Unternehmen, gründeten eine Lauf-Internetseite (die leider nach 18 Monaten wieder eingestellt werden musste) und … neben der Arbeit liefen wir auch tatsächlich gemeinsam. Ich war damals noch ein waschechter Mittelstreckenläufer mit meinen Spezialstrecken 800 m und 1.500 m, Peter war gerade dabei sich für sein Marathondebüt vorzubereiten. Aus irgendeinem Grund hatte er sich ein Team für den Gigathlon zusammengestellt. Der Gigathlon in der Schweiz ist ein Ultra-Ausdauerrennen, das man alleine, zu zweit oder als 5er-Team absolvieren kann. Peter hatte sich für das 5er-Team entschieden. An zwei Tagen mussten fünf Kilometer geschwommen, 71 km (1.250 Höhenmeter) gelaufen, 139 km (4.000 Höhenmeter) mit dem Mountainbike und 159 km (2.750 Höhenmeter) mit dem Rennrad geradelt, sowie mit Inline-Skates 42 Kilometer zurückgelegt werden. Er erzählte mir von seinem Vorhaben und erwähnte so nebenbei, dass ihm derzeit ein Teammitglied fehle. Ich überlegte schon, wie ich ihm schonend beibringen könnte, dass ich auf gar keinen Fall an einem Wochenende einen Marathon und dazu weitere 30 Kilometer laufen könnte, schließlich befand ich mich mitten in meiner Bahnsaison und die Saisonhöhepunkte standen noch bevor. Außerdem war ich in den vergangenen zwei Monaten nur einmal länger als eine Stunde gelaufen. Ich dachte bereits nach, wer den Laufpart übernehmen könnte, doch Peter suchte gar keinen Läufer, sondern einen Mountainbiker. Es waren noch drei Wochen bis zu dem Rennen in der Schweiz und der planmäßige Mountainbiker war kurzfristig abgesprungen. Da Peter wusste, dass ich keinerlei Erfahrungen mit Mountainbike-Rennen hatte und nicht einmal ein eigenes Fahrrad besaß, fragte er mich, ob ich jemanden kenne, der einspringen könnte. Da mir spontan niemand einfiel, machte ich den Vorschlag, dass ich ja für das Team laufen könnte und der planmäßige Läufer, der zumindest über ein bisschen Raderfahrung verfügte, sich auf das Mountainbike setzen könnte. Dieser Vorschlag war natürlich nicht wirklich ernst von mir gemeint, denn ich hatte keine Lust (und natürlich nicht den nötigen Trainingsstatus) um diese extreme Laufbelastung durchzustehen. Gott sei Dank lehnte Peter den Vorschlag ab, da sich der für die Laufdistanzen vorgeschlagene Athlet bereits in der unmittelbaren Vorbereitung für den Marathon befand. Erleichtert von dieser Antwort ließ ich mich zu einem weiteren Statement hinreißen: „Wenn du niemand anderen findest, dann springe ich schon ein. 100 Kilometer mit dem Mountainbike mit fast 3.000 Höhenmetern werde ich schon schaffen.“ Peter versicherte sich nochmals bei mir, ob ich das wirklich ernst meine. Ich schaute ihn nur fragend an und bestätigte erneut, dass ich für das Team zur Verfügung stünde, falls er niemanden auftreiben könnte. Tja, hätte ich das besser einmal nicht getan.
Читать дальше