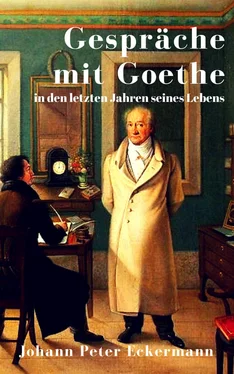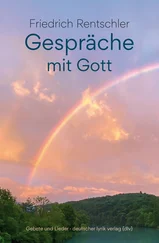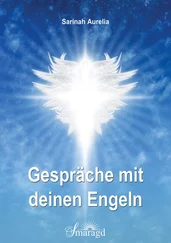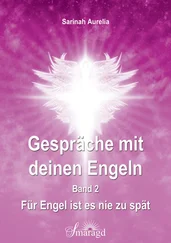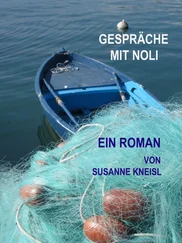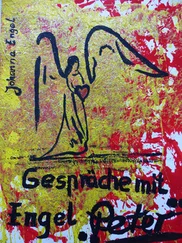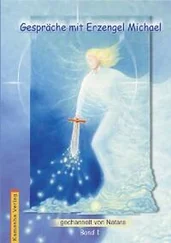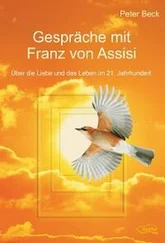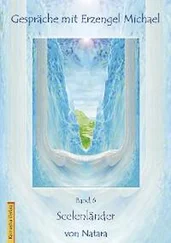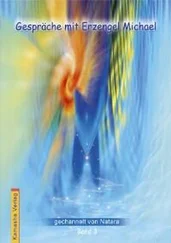Ich merkte mir diese guten Worte und nahm mir vor, soviel wie möglich danach zu handeln.
Gegen Abend hatte Goethe mich zu einer Spazierfahrt einladen lassen. Unser Weg ging durch Oberweimar über die Hügel, wo man gegen Westen die Ansicht des Parkes hat. Die Bäume blühten, die Birken waren schon belaubt und die Wiesen durchaus ein grüner Teppich, über welche die sinkende Sonne herstreifte. Wir suchten malerische Gruppen und konnten die Augen nicht genug auftun. Es ward bemerkt, daß weißblühende Bäume nicht zu malen, weil sie kein Bild machen, sowie daß grünende Birken nicht im Vordergrunde eines Bildes zu gebrauchen, indem das schwache Laub dem weißen Stamme nicht das Gleichgewicht zu halten vermöge; es bilde keine große Partieen, die man durch mächtige Licht- und Schattenmassen herausheben könne. »Ruysdael«, sagte Goethe, »hat daher nie belaubte Birken in den Vordergrund gestellt, sondern bloße Birken- Stämme, abgebrochene, die kein Laub haben. Ein solcher Stamm paßt vortrefflich in den Vordergrund, denn seine helle Gestalt tritt auf das mächtigste heraus.«
Wir sprachen sodann, nach flüchtiger Berührung anderer Gegenstände, über die falsche Tendenz solcher Künstler, welche die Religion zur Kunst machen wollen, während ihnen die Kunst Religion sein sollte. »Die Religion«, sagte Goethe, »steht in demselbigen Verhältnis zur Kunst wie jedes andere höhere Lebensinteresse auch. Sie ist bloß als Stoff zu betrachten, der mit allen übrigen Lebensstoffen gleiche Rechte hat. Auch sind Glaube und Unglaube durchaus nicht diejenigen Organe, mit welchen ein Kunstwerk aufzufassen ist, vielmehr gehören dazu ganz andere menschliche Kräfte und Fähigkeiten. Die Kunst aber soll für diejenigen Organe bilden, mit denen wir sie auffassen; tut sie das nicht, so verfehlt sie ihren Zweck und geht ohne die eigentliche Wirkung an uns vorüber. Ein religiöser Stoff kann indes gleichfalls ein guter Gegenstand für die Kunst sein, jedoch nur in dem Fall, wenn er allgemein menschlich ist. Deshalb ist eine Jungfrau mit dem Kinde ein durchaus guter Gegenstand, der hundertmal behandelt worden und immer gern wieder gesehen wird.«
Wir waren indes um das Gehölz, das Webicht, gefahren und bogen in der Nähe von Tiefurt in den Weg nach Weimar zurück, wo wir die untergehende Sonne im Anblick hatten. Goethe war eine Weile in Gedanken verloren, dann sprach er zu mir die Worte eines Alten:
Untergehend sogar ists immer dieselbige Sonne.
»Wenn einer fünfundsiebzig Jahre alt ist,« fuhr er darauf mit großer Heiterkeit fort, »kann es nicht fehlen, daß er mitunter an den Tod denke. Mich läßt dieser Gedanke in völliger Ruhe, denn ich habe die feste Überzeugung, daß unser Geist ein Wesen ist ganz unzerstörbarer Natur; es ist ein fortwirkendes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist der Sonne ähnlich, die bloß unsern irdischen Augen unterzugehen scheint, die aber eigentlich nie untergeht, sondern unaufhörlich fortleuchtet.«
Die Sonne war indes hinter dem Ettersberge hinabgegangen; wir spürten in dem Gehölz einige Abendkühle und fuhren desto rascher in Weimar hinein und an seinem Hause vor. Goethe bat mich, noch ein wenig mit hinaufzukommen, welches ich tat. Er war in äußerst guter, liebenswürdiger Stimmung. Er sprach darauf besonders viel über die Farbenlehre, über seine versteckten Gegner, und daß er das Bewußtsein habe, in dieser Wissenschaft etwas geleistet zu haben.
»Um Epoche in der Welt zu machen,« sagte er bei dieser Gelegenheit, »dazu gehören bekanntlich zwei Dinge: erstens, daß man ein guter Kopf sei, und zweitens, daß man eine große Erbschaft tue. Napoleon erbte die Französische Revolution, Friedrich der Große den Schlesischen Krieg, Luther die Finsternis der Pfaffen, und mir ist der Irrtum der Newtonischen Lehre zuteil geworden. Die gegenwärtige Generation hat zwar keine Ahnung, was hierin von mir geleistet worden; doch künftige Zeiten werden gestehen, daß mir keineswegs eine schlechte Erbschaft zugefallen.«
Goethe hatte mir heute früh ein Konvolut Papiere in bezug auf das Theater zugesendet; besonders fand ich darin zerstreute einzelne Bemerkungen, die Regeln und Studien enthaltend, die er mit Wolf und Grüner durchgemacht, um sie zu tüchtigen Schauspielern zu bilden. Ich fand diese Einzelnheiten von Bedeutung und für junge Schauspieler in hohem Grade lehrreich, weshalb ich mir vornahm, sie zusammenzustellen und daraus eine Art von Theaterkatechismus zu bilden. Goethe billigte dieses Vorhaben, und wir sprachen die Angelegenheit weiter durch. Dies gab Veranlassung, einiger bedeutender Schauspieler zu gedenken, die aus seiner Schule hervorgegangen, und ich fragte bei dieser Gelegenheit unter andern auch nach der Frau von Heygendorf. »Ich mag auf sie gewirkt haben,«sagte Goethe, »allein meine eigentliche Schülerin ist sie nicht. Sie war auf den Brettern wie geboren und gleich in allem sicher und entschieden gewandt und fertig, wie die Ente auf dem Wasser. Sie bedurfte meiner Lehre nicht, sie tat instinktmäßig das Rechte, vielleicht ohne es selber zu wissen.«
Wir sprachen darauf über die manchen Jahre seiner Theaterleitung, und welche unendliche Zeit er damit für sein schriftstellerisches Wirken verloren. »Freilich,« sagte Goethe, »ich hätte indes manches gute Stück schreiben können, doch wenn ich es recht bedenke, gereut es mich nicht. Ich habe all mein Wirken und Leisten immer nur symbolisch angesehen, und es ist mir im Grunde ziemlich gleichgültig gewesen, ob ich Töpfe machte oder Schüsseln.«
Donnerstag, den 6. [Sonntag, den 16.] Mai 1824
Als ich im vorigen Sommer nach Weimar kam, war es, wie gesagt, nicht meine Absicht, hier zu bleiben, ich wollte vielmehr bloß Goethes persönliche Bekanntschaft machen und dann an den Rhein gehen, wo ich an einem passenden Ort längere Zeit zu verweilen gedachte.
Gleichwohl ward ich in Weimar durch Goethes besonderes Wohlwollen gefesselt; auch gestaltete sich mein Verhältnis zu ihm immer mehr zu einem praktischen, indem er mich immer tiefer in sein Interesse zog und mir, als Vorbereitung einer vollständigen Ausgabe seiner Werke, manche nicht unwichtige Arbeit übertrug.
So stellte ich im Laufe dieses Winters unter andern verschiedene Abteilungen ›Zahmer Xenien‹ aus den konfusesten Konvoluten zusammen, redigierte einen Band neuer Gedichte sowie den erwähnten Theaterkatechismus und eine skizzierte Abhandlung über den Dilettantismus in den verschiedenen Künsten.
Jener Vorsatz, den Rhein zu sehen, war indes in mir beständig wach geblieben, und damit ich nicht ferner den Stachel einer unbefriedigten Sehnsucht in mir tragen möchte, so riet Goethe selber dazu, einige Monate dieses Sommers auf einen Besuch jener Gegenden zu verwenden.
Es war jedoch sein ganz entschiedener Wunsch, daß ich nach Weimar zurückkehren möchte. Er führte an, daß es nicht gut sei, kaum geknüpfte Verhältnisse wieder zu zerreißen, und daß alles im Leben, wenn es gedeihen wolle, eine Folge haben müsse. Er ließ dabei nicht undeutlich merken, daß er mich in Verbindung mit Riemer dazu ausersehen, ihn nicht allein bei der bevorstehenden neuen Ausgabe seiner Werke tätigst zu unterstützen, sondern auch jenes Geschäft mit gedachtem Freunde allein zu übernehmen, im Fall er bei seinem hohen Alter abgerufen werden sollte.
Er zeigte mir diesen Morgen große Konvolute seiner Korrespondenz, die er im sogenannten Büstenzimmer hatte auseinander legen lassen. »Es sind dies alles Briefe,« sagte er, »die seit Anno 1780 von den bedeutendsten Männern der Nation an mich eingegangen; es steckt darin ein wahrer Schatz von Ideen, und es soll ihre öffentliche Mitteilung Euch künftig vorbehalten sein. Ich lasse jetzt einen Schrank machen, wohinein diese Briefe nebst meinem übrigen literarischen Nachlasse gelegt werden. Das sollen Sie erst alles in Ordnung und beieinander sehen, bevor Sie Ihre Reise antreten, damit ich ruhig sei und eine Sorge weniger habe.«
Читать дальше