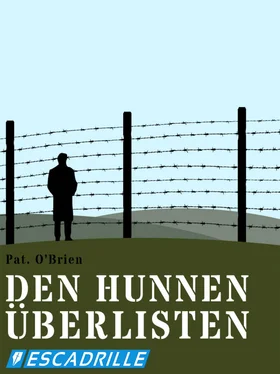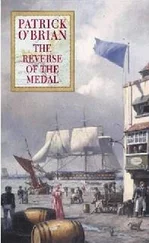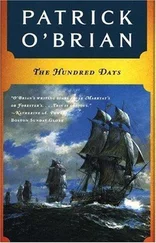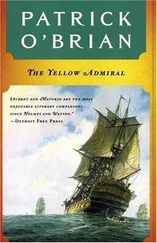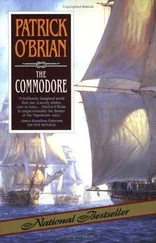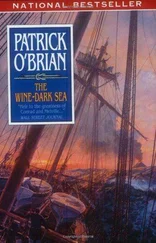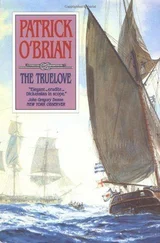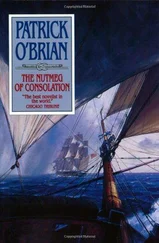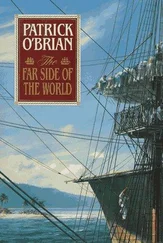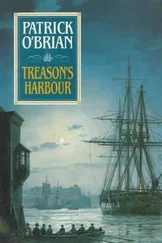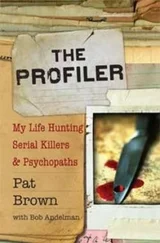Er erzählte mir, dass er natürlich, als der Krieg erklärt wurde, sehr patriotisch gewesen sei und gedacht habe, dass es das einzig Richtige sei, zurückzukehren und die Verteidigung seines Landes zu unterstützen. Er fand heraus, dass er nicht direkt von San Francisco fahren konnte, da die Engländer die Gewässer gut beschützten, also bestieg er ein Boot nach Südamerika. Dort besorgte er sich einen gefälschten Ausweis und in der Verkleidung eines Montevideaners nahm er eine Überfahrt nach New York und von dort nach England.
Er durchquerte England ohne Probleme mit seinem gefälschten Ausweis, aber entschied sich, es nicht zu riskieren, nach Holland zu gehen, da er befürchtete, zu viel Aufmerksamkeit zu erregen, also fuhr er runter durch die Straße von Gibraltar nach Italien, das zu dieser Zeit neutral war, hoch nach Österreich und von dort aus nach Deutschland. Er sagte, dass, als er, nachdem er England verlassen hatte, das Schiff nach Gibraltar bestieg, zwei Verdächtige vom Boot geholt worden seien – Männer, von denen er sich dachte, dass sie neutrale Bürger seien –, aber zu seiner Erleichterung waren sein eigener Passport und seine Anmeldedaten okay.
Der Hunne sprach von seiner Reise von Amerika nach England als besonders angenehm und sagte, dass er eine tolle Zeit gehabt habe, da er sich den englischen Reisenden an Bord angeschlossen habe; sein fließendes Englisch erlaubte es ihm, mehrere kühne Argumente für den Krieg aufzubringen, was er mit Begeisterung genoss.
Unser kleiner Vorfall offenbarte den bemerkenswerten Takt, mit dem unser Feind seine Verbindung auf See zur Schau gstellt hatte, was sich zweifellos vorteilhaft für ihn herausstellte. Wie er es ausdrückte, hatte er eines Abends großen Erfolg, als sich die Gruppe für etwas Musik versammelt hatte und er vorschlug, »God Save the King« zu singen. Danach war seine Popularität gesichert und der gewünschte Effekt erreicht, da kurz danach ein französischer Offizier zu ihm kam und sagte: »Es ist zu schade, dass England und unsere eigene Armee über keine Männer wie Sie verfügen.« »Es ist zu schade«, stimmte er zu, als er es mir erzählte, denn er war davon überzeugt, dass er für Deutschland so viel mehr hätte erreichen können, wenn er in der englischen Armee gewesen wäre.
Trotz seiner offensichtlichen Loyalität schien der Mann offensichtlich nicht sehr enthusiastisch dem Krieg gegenüber zu sein, und er gab offen zu, dass ihm die alten politischen Kämpfe in Kalifornien viel mehr zusagten als die Kämpfe, durch die er hier herübergegangen war. Beim zweiten Gedanken lachte er, als wäre er ein guter Witz gewesen, aber offensichtlich wollte er, dass ich schlussfolgerte, dass er ein großes Interesse an der Politik San Franciscos gefunden hatte.
Als mein »kumpelhafter Feind« seine Unterhaltung mit mir begonnen hatte, wurde er vom diensthabenden deutschen Arzt getadelt, aber er schenkte dem Arzt keine Aufmerksamkeit, was zeigte, dass er in der Zeit, in der er in den USA gewesen war, etwas echten Amerikanismus in sein System aufgenommen hatte.
Ich fragte ihn eines Tages, was er denke, was die deutschen Leute nach dem Krieg machen würden, ob er denke, dass sie eine Deutsche Republik erklären würden, und zu meiner Überraschung sagte er sehr verbittert: »Wenn es nach mir ginge, würde ich sie zu einer Republik machen und würde den verdammten Kaiser im Keller erhängen.« Und trotzdem wurde er als exzellenter Soldat geschätzt. Ich entschied jedoch, dass er ein deutscher Sozialist gewesen sein musste, obwohl er es mir nie sagte.
Bei einer Gelegenheit fragte ich nach seinem Namen, aber er sagte, dass er mich sicherlich nie wiedersehen würde und es egal sei, wie sein Name sei. Ich wusste nicht, ob er das meinte, weil die Deutschen mich verhungern lassen würden oder weil das gerade in seinen Gedanken war, da ich mir sicher bin, dass er zu der Zeit nicht davon ausging, bald zu sterben. Die ersten beiden oder drei Tage, in denen ich im Krankenhaus war, dachte ich, dass er sicherlich bald wieder fit wäre und längst weg wäre, bevor ich es war, aber er bekam etwa zu dieser Zeit eine Blutvergiftung und nur ein paar Stunden, bevor ich nach Courtrai ging, starb er.
An einem dieser Tag, während meine Wunde immer noch Probleme machte, wurde mir ein Apfel gegeben; ob es war, um mich zu quälen, da man wusste, dass ich ihn nicht essen konnte, oder aus einem anderen Grund, weiß ich nicht. Jedenfalls hatte ein deutscher Fliegeroffizier mehrere in seinen Taschen und gab mir einen Schönen. Natürlich gab es keine Möglichkeit für mich, den Apfel zu essen; als der Offizier gegangen war und ich bemerkte, dass der Typ aus San Francisco ihn recht lang anschaute, nahm ich ihn also in die Hand, da ich ihn zu ihm herüberwerfen wollte. Aber er schüttelte den Kopf und sagte: »Wenn dies San Francisco wäre, würde ich ihn nehmen, aber ich kann ihn nicht hier von dir nehmen.« Ich konnte nie verstehen, warum er den Apfel ablehnte, da er besonders gesellig war und ich mich mit ihm gut unterhielt, aber offensichtlich konnte er nicht vergessen, dass ich sein Feind war. Jedoch hielt dies den einen Krankenpfleger nicht davon ab, den Apfel zu essen.
Eine Praxis in diesem Krankenhaus, die mich beeindruckte, war, dass wenn ein deutscher Soldat keine große Chance hatte, sich hinreichend zu erholen, um wieder seinen Platz im Krieg einzunehmen, sich die Ärzte nicht sehr anstrengten, um dafür zu sorgen, dass er wieder gesund wurde. Aber wenn ein Mann eine sehr gute Chance auf Genesung hatte und sie dachten, dass er für eine weitere Verwendung geeignet sei, wurde alles Mögliche für ihn gemacht, was mit medizinischem Können möglich war. Ich weiß nicht, ob dies auf Befehl getan wurde oder ob die Ärzte in solchen Fällen ihren eigenen Neigungen folgten.
Meine Zähne waren von dem Schuss stark gescharrt und ich hoffte, dass ich die Chance haben würde, sie richten zu lassen, wenn ich Courtrai, das Gefängnis, in das ich gebracht werden sollte, erreichte. Also fragte ich den Arzt, ob es möglich sei, dass diese Arbeit hier gemacht würde, aber er sagte mir recht schroff, dass es mehrere Zahnärzte in Courtrai gebe und sie genügend damit zu tun hätten, die Zähne ihrer eigenen Männer zu richten, ohne sich mit meinen zu beschäftigen. Er fügte außerdem hinzu, dass ich mir um meine Zähne keine Sorgen machen müsse, da ich nicht so viel Essen bekommen würde, dass sie Überstunden machen müssten. Ich wollte ihm sagen, dass, so wie es hier aussah, er seine ebenfalls nicht so schnell abnutzen würde.
Mein Zustand verbesserte sich in den nächsten zwei Tagen, und am vierten Tag meiner Gefangenschaft war ich fit genug, um eine kurze Nachricht an meine Schwadron zu schreiben, in der ich berichtete, dass ich Kriegsgefangener war und mich »gut fühlte«, aber in Wirklichkeit war ich in meinem Leben niemals derart deprimiert gewesen. Ich erkannte jedoch, dass, wenn diese Nachricht meine Kameraden erreichte, sie an meine Mutter in Momence, Illinois, weitergeleitet würde, und ich wollte nicht, dass sie sich mehr Sorgen machte als absolut nötig. Es war schlimm genug für sie, zu wissen, dass ich Kriegsgefangener war. Sie musste nicht wissen, dass ich verwundet war.
Ich hatte die Hoffnung, dass meine Nachricht über die Linien getragen würde und von einem der deutschen Fliegeroffiziere abgeworfen würde. Das ist eine Gefälligkeit, die üblicherweise auf beiden Seiten gemacht wird. Ich erinnerte mich, wie geduldig wir auf Nachrichten über unsere Männer, die nicht zurückgekehrt waren, gewartet hatten, und ich konnte mir im Geiste meine Schwadron vorstellen, wie sie über mein Schicksal spekulierten.
Das ist eines der traurigsten Dinge, die mit dem R.F.C. zu tun haben. Man kümmert sich nicht viel darum, was einem passiert, aber die ständigen Verluste unter den Freunden sind sehr deprimierend.
Man geht mit seiner Staffel raus und kommt in einen Wirrwarr. Man wird verstreut und wenn die Formation aufgebrochen wird, findet man endlich seinen Weg alleine nach Hause.
Читать дальше