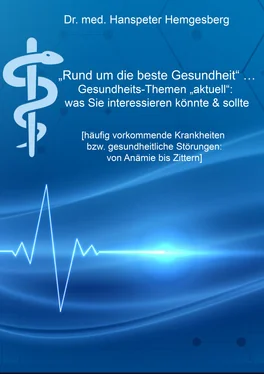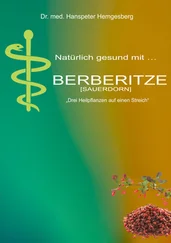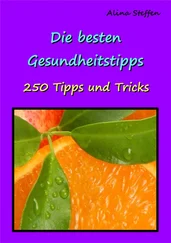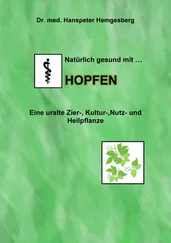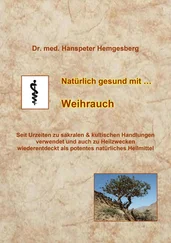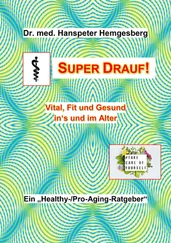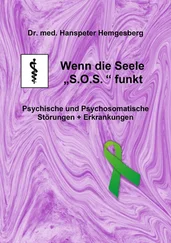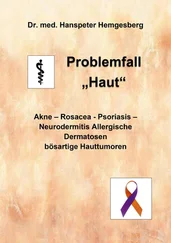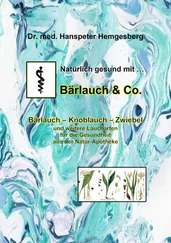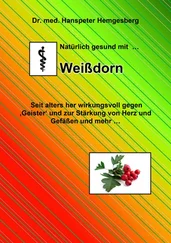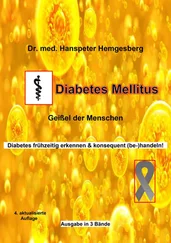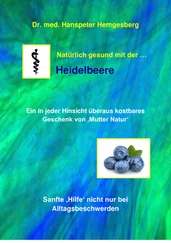II. Unspezifisches (angeborenes) Immunsystem
Das unspezifische Immunsystem ist in der Lage, Fremdkörper und viele allgemein vorkommende Krankheitserreger bereits beim ersten Kontakt unschädlich zu machen. Dies wird deshalb auch als angeborene Immunabwehr bezeichnet.
Diese angeborene Immunabwehr ist für die Bekämpfung bakterieller Infektionen von großer Bedeutung.
Zum unspezifischen Immunsystem gehören zelluläre und nicht-zelluläre (humorale) Mechanismen.
Zelluläre Faktoren
Die Abwehrzellen des unspezifischen Immunsystems sind die Phagozyten , die den Erreger oder Fremdkörper aufnehmen und ihn „verdauen“.
Zu den Phagozyten gehören neutrophile und eosinophile Granulozyten, Makrophagen und Monozyten. Teilweise werden auch Lymphozyten, Mastzellen und Fibroblasten zu den Phagozyten gezählt. Diese nehmen zwar gelegentlich auch Fremdpartikel auf, verdauen diese aber nicht, sondern geben sie in Interzellulärräume ab, wo sie von den eigentlichen Phagozyten vernichtet werden.
Humorale Faktoren
Die sogen. humoralen, d.h. die in den Körperflüssigkeiten gelösten Faktoren des unspezifischen Immunsystems, sind bakterizid wirkende (= Bakterien-tötende) Substanzen.
Dazu gehört das Enzym Lysozym, das in verschiedenen Körpersekreten wie Tränenflüssigkeit und Speichel enthalten ist und die Zellwand zahlreicher Bakterien angreift.
Daneben gibt es das sogen. Komplementsystem.
Es handelt sich um ein von der Leber gebildetes Enzymsystem, das aus einer Gruppe von etwa 20 Bluteiweißkörpern besteht und zur Auflösung körper-fremder Zellen führt.
Darüber hinaus gehören auch sogen. Interferone, die sich vorwiegend gegen Viren richten, zur unspezifischen humoralen Immunabwehr.
Hinweis:
Neben den humoralen und zellulären Mechanismen unterstützen weitere Faktoren die Immunabwehr des unspezifischen Immunsystems .
So bietet die gesunde Haut einen natürlichen Schutz vor dem Eindringen von Krankheitserregern. Magensaft vernichtet durch seinen hohen Säure-Gehalt Bakterien, die mit der Nahrung aufgenommen werden.
Krankheitserreger, die durch die Atemluft in die Luftwege geraten, bleiben dort am von der Schleimhaut gebildeten Schleim hängen und werden durch den Schlag der Flimmerhaare aus dem Körper geschleust. Niesen oder Husten dienen dem gleichen Ziel.
III. „Bestandteile“ des Immunsystems
1. Bestandteile des IS
mechanische Barrieren, die ein Eindringen der Schädlinge verhindern sollen
Zellen, wie zum Beispiel Granulozyten, natürliche Killerzellen ( NK-Zellen)
oder T-Lymphozyten(T-Zellen). Sie sind teilweise zu spezialisierten Organen (→ Lymphatisches System) zusammengefasst.
Eiweiße, die als Botenstoffe oder zur Abwehr von Krankheitserregern dienen
psychische Immunfaktoren.
2. Mechanische und physiologische Barrieren
Sie sind die erste Verteidigungslinie des Organismus gegen Krankheits-Erreger. Sie sorgen dafür, dass die Pathogeneerst gar nicht in den Körper eindringen können oder ihn möglichst schnell wieder verlassen:
Haut- äußere Schicht als Barriere, Talg, Schweißund Normalflora- als
Wachstumsbremsen für pathogene Mikroorganismen
Schleimhaut– Bindefunktion des Schleims
Augen– Abtransportfunktion der Tränen; das antimikrobielle Enzym
Lysozymbekämpft Mikroorganismen;
Atemwege– Bindefunktion des Schleims, Abtransportfunktion der
Flimmer-Häarchen;
Mundhöhle– das antimikrobielle Enzym Lysozym im Speichelbekämpft
Mikro-Organismen;
Magen– Magensäure(enthält Salzsäure) und Eiweiß-abbauende Enzyme
zerstören fast alle Bakterien und Mikroorganismen;
Darm– Infektabwehr durch anwesende Bakterien ( Darmflora),
Abtransportfunktion durch ständige Entleerung und das sogen. Darm-assoziierte Immunsystem(„GALT“ – gut associated lymphoid tissue) und antibakterielle Proteine;
Harntrakt– Abtransportfunktion durch ständige Harnausspülung sowie
osmotische Effekte der hohen Harnstoffkonzentration.
IV. Immunreaktion / Immunantwort
Gelangen Fremdstoffe oder Krankheitserreger in den Organismus, werden sie von Makrophagen () erkannt, aufgenommen und in die Lymphgewebe des Immunsystems transportiert. Dort werden ihre Antigene den T- bzw. B-Lymphozyten (T- bzw. B-Zellen) () präsentiert, wodurch spezifische Immun-Reaktionen ausgelöst werden.
Die B-Lymphozyten bilden Antikörper, die mit dem entsprechenden Antigen der im Körper verbliebenen Fremdstoffe oder Erreger einen Antigen-Antikörper-Komplex bilden; die Antigene werden „neutralisiert“! Von den Phagozyten () werden diese „Antigen-Antikörper-Komplexe“ aus dem Blut entfernt.
Neben der Bildung von Antikörpern durch B-Lymphozyten werden auch T-Lymphozyten aktiviert, die die Krankheitserreger direkt zerstören können.
Außerdem werden bestimmte Zellen des unspezifischen Immun-Systems mit zellzerstörender Wirkung, sogen. zytotoxische Zellen , aktiviert, die die Fremdkörper direkt schädigen.
Durch die Freisetzung von Stoffen, welche die Blutgefäße erweitern bzw. die Gefäßwand durchlässiger machen (z.B. Histamine, Komplementfaktoren), entzündet sich das infizierte Gewebe – verbunden mit den typischen Entzündungszeichen Rötung, Schwellung, Erwärmung, Schmerz und eingeschränkter Gewebefunktion. Durch die be-gleitende Aktivierung und Vermehrung der Lymphozyten und die gesteigerte Durchblutung wer-den die Lymphknoten bzw. die Milz häufig vergrößert.
Eine zentrale Rolle nehmen bei der peripheren Immun-Antwort/ Immun-Reaktion die Zytokine (s.u.) ein. Die Messung der Konzentration der Interleukine IL-10 und IL-12 eignet sich als „Biologischer Marker“ für die periphere Th-1/Th-2-Immunantwort (Th-1: zelluläre Immunantwort – Th-2: humorale Immunantwort).
V. Immunologisches Gedächtnis
Durch die Bildung von B- bzw. T-Gedächtniszellen ist das Immunsystem in der Lage, sich an die fremde Oberflächenstruktur zu erinnern, so dass es bei einem erneuten Kontakt des Körpers mit dem gleichen Krankheits-Erreger rascher und mit stärkerer Antikörperproduktion reagieren kann als beim ersten Mal.
Dieses Phänomen wird als immunologisches Gedächtnis bezeichnet.
Der Lernprozess des Immun-Systems kann die Abwehrfähigkeit des Organismus so verändern, dass bei einer wiederholten Infektion mit dem gleichen Erreger keinerlei Krankheitssymptome auftreten:
Der Körper ist gegen diesen Erreger „immun“.
VI. Immunität
d.i. die „Unempfänglichkeit“ des Organismus gegen ein Antigen (Erreger, Toxin …).
Dieses Prinzip – die Bildung von Immunität durch das Immunsystem des Körpers – wird bei Schutzimpfungen gegen Krankheitserreger genutzt. Es gilt zu unterscheiden:
1. Angeborene Immunität
= unspezifische oder genetische oder konstitutionelle I. – d.h.: I., die auf „natürlichen Abwehrmechanismen“ beruht (Schleimhaut-Barriere, anti-mikrobielle Enzyme …)
2. Erworbene Immunität
= spezifische I. – d.h.: nach einem Erstkontakt vorhandene I. gegen ein bestimmtes Antigen.
3. Antitoxische Immunität
= gegen Toxine gerichtete I.
4. Begleitende Immunität
= sogen. „Prä-Immunität“ – d.h.: I., welche nur während eines Infektes vorhanden ist und die nach Verschwinden des Erregers erlischt.
5. Zellvermittelte Immunität
= zelluläre I. – d.h.: I. durch immun-kompetente Zellen (T-Lymphozyten, Makrophagen).
VII. Immunisierung
d.i. die Herbeiführung einer Immunität. Es ist zu unterscheiden zwischen:
Aktive Immunisierung
= I. durch direkten/unmittelbaren Kontakt mit einem Antigen (z.B. Schutz-Impfung, Infektion)
Passive Immunisierung
= Immunisierung durch Gabe von „fertigen Antikörpern“ gegen das
Читать дальше