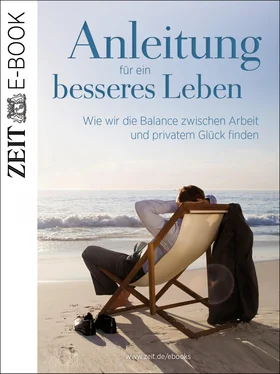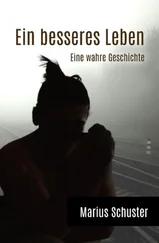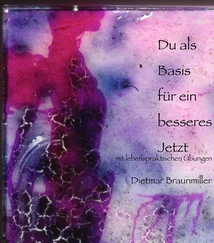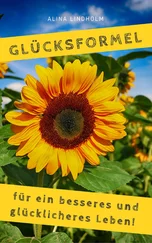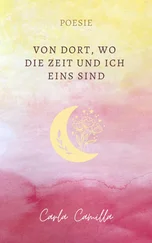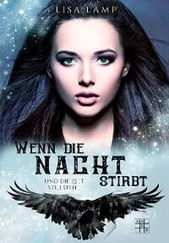Es war dieser Schutz, der Christiane Schöss* am Ende fehlte.
Sie ist Ende 30 und leitet die IT-Abteilung in einem Verlag mit 500 Mitarbeitern. Für sie ein Traumjob. Sie verdient viel Geld, bekommt außerdem Boni, Sonderprämien, Dienstwagen und einen Tiefgaragenstellplatz. Sie darf sich Chief Information Officer, kurz CIO, nennen und findet, dass sich das gut anhört. Sie lebt in der Großstadt, ist alleinstehend, hat keine Kinder, aber das kann ja noch kommen, jetzt will sie erst einmal etwas leisten, und außerdem hat sie ja einen großen Freundeskreis. Der kleiner wird. Und kleiner.
Es fängt damit an, dass sie Verabredungen absagt. Kino? Squash? Ein Ausflug mit ihrem Patenkind? Ein andermal. Zuerst sucht sie nach Entschuldigungen, später wird sie gar nicht mehr gefragt. Irgendwann trifft sie nach dem Büro eine Freundin auf einen schnellen Kaffee, als diese plötzlich schimpft: »Sag mal, du redest ja nur noch über deine Arbeit. Du hast überhaupt nichts anderes mehr im Kopf!«
Da, sagt Christiane Schöss, habe sie erstmals gemerkt, wie sehr sie alles andere im Leben beiseitegeschoben hatte. Einen Moment lang ist sie geschockt. Dann, wie aus Trotz, vertieft sie sich noch mehr in ihren Job. Gibt ja allen Grund dazu – neue Projekte, die Finanzkrise. Außerdem liebt sie ihre Arbeit. Irgendwann aber liebt ihre Arbeit sie nicht mehr. Die Geschäftsführung gibt ihr immer neue Aufträge, macht Druck, mäkelt an ihr herum. Ihr ist, als sei sie verlassen worden. Christiane Schöss ist immer noch CIO, aber sie hat nicht mehr das Gefühl, es geschafft zu haben. Es kommt ihr vor, als sei sie gescheitert.
Wenn sie jetzt abends nach Hause kommt, hat sie nicht einmal mehr die Kraft, die Waschmaschine anzuschalten. Sie fängt an zu weinen – wegen nichts. Kriegt Wutanfälle – wegen Kleinigkeiten. Nach einem Urlaub, der nicht hilft, geht sie zum Arzt. Die Diagnose: Erschöpfungsdepression. Nach Ansicht des Medizinsoziologen Johannes Siegrist ein klassischer Fall: »Erwerbstätige, die für ihren starken Einsatz nicht die nötige Wertschätzung bekommen, sind besonders gefährdet, vor allem wenn ihr Beruf die einzige Quelle persönlicher Anerkennung darstellt.«
Es gibt natürlich in der Arbeitsgesellschaft auch Ursachen seelischer Erkrankungen, die nichts mit dem Beruf zu tun haben, sie mögen in der Familie gründen, der Kindheit, einer missglückten Ehe. Und doch fällt auf, dass die Zunahme der psychischen Zusammenbrüche in eine Zeit fällt, in der den meisten Menschen in den Industrieländern, zumindest theoretisch, eine große Zukunft offensteht.
Egal, ob Männer oder Frauen, ob Arbeiter- oder Akademikerkinder: Sie können ihr eigenes Leben führen. Sie können studieren, Karriere machen, Kinder kriegen oder es bleiben lassen. Es liegt an ihnen, und das ist das Problem. Der französische Soziologe Alain Ehrenberg hat es vor wenigen Jahren in seinem Buch Das erschöpfte Selbst beschrieben: Wo alles erreichbar, alles möglich scheint, steigen die Ansprüche. Dafür sinkt die Zahl akzeptabler Entschuldigungen. Am Ende liegt das Scheitern nur am eigenen Ich. Wenn aber jeder für sich selbst verantwortlich ist, dann muss auch jeder selbst die Last des Erfolgszwangs tragen. Und manche brechen darunter zusammen.
An wenigen Orten zeigt sich das so deutlich wie an den Universitäten. Dort, in Göttingen zum Beispiel, nicht weit von den Uni-Cafés und Studentenkantinen, steht, leicht zurückgesetzt, ein mittelgroßes weißes Gebäude, ein Zweckbau, auffällig nur wegen eines silbernen Schildes an der Wand. »Psychotherapeutische Ambulanz für Studierende« steht darauf.
Hierher kommen Studenten, die mit dem Leben hadern oder den Glauben an sich selbst verlieren. Seit 45 Jahren gibt es die Beratungsstelle, aber erst seit wenigen Jahren beobachten die Therapeuten, dass ihnen vermehrt junge Leute gegenübersitzen, mit denen alles in Ordnung zu sein scheint. Sie sind selbstbewusst, haben Freunde, intakte Familien, ihre Köpfe sollten voll sein mit Plänen und Zukunftsfreude. Stattdessen ist da nur ein einziges Gefühl, erzeugt von neuen Prüfungsordnungen, Masterstudiengängen und vergeblichen Versuchen, den eigenen Lebenslauf zu optimieren. Sie sitzen da, die Studenten, in einem dieser kleinen Beratungszimmer, sind erst Anfang oder Mitte 20 und sagen schon jetzt nur diesen einen Satz: Ich kann nicht mehr.
*Namen von der Redaktion geändert
Tinnitus: Rund drei Millionen Deutsche leiden unter dem chronischen Klingeln im Ohr. Tinnitus kann mit psychischen Begleiterscheinungen wie Schlafstörungen, Angstzuständen oder Depression einhergehen. Eine allgemein anerkannte Therapie gibt es nicht. In Versuchen an Ratten konnten Wissenschaftler der University of Texas die Tiere heilen, indem sie bestimmte Nerven des Gehirns per Elektrostimulation reizten.
Phantomschmerz: Zwischen 50 und 80 Prozent der Patienten mit Amputationen haben diese Empfindungen: Ein fehlendes Körperteil fühlt sich so an, als sei es noch da. In zahlreichen Studien konnte nach dem Verlust eines Körperteils eine Veränderung von jenen Gehirnfunktionen festgestellt werden, die für die Verarbeitung von Schmerzempfindungen verantwortlich sind. Es existieren einige vielversprechende Therapieansätze, die die Gehirnfunktionen normalisieren sollen.
Volkskrankheit: So werden nicht epidemische Krankheiten bezeichnet, die aufgrund ihrer Verbreitung und ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen sozial ins Gewicht fallen. Dazu zählen heute etwa die Folgeerkrankungen von Bewegungsmangel und Überernährung. Der Begriff wurde erstmals 1832 von dem Medizinhistoriker Justus Hecker verwandt. Er bezeichnete damit die im Mittelalter grassierende Tanzwut.
Protektoren: Das Wort stammt vom lateinischen »protector«, Angehöriger der Leibgarde. Bestimmte persönliche Umstände wie familiärer Rückhalt oder finanzielle Sicherheit können als Protektoren gegen psychische Erkrankungen wirken.
Der Weg zurück
Diagnose Burn-out, und dann? Was nach der Krankschreibung passiert, ist nicht geregelt. Wie Patienten trotzdem gesund werden.
Von Susanne Schäfer
Eigentlich dachte Christian Bergmann*, er könne sich mit neuer Kraft seiner Arbeit widmen, schließlich war er gerade aus dem Urlaub gekommen. Er begann, die 300 neuen Mails zu lesen. »Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass ich gar nicht registrieren konnte, worum es darin ging«, erzählt er. »Ich dachte nur: Das kannst du nicht alles an einem Tag erledigen!« Eine schreckliche Vorstellung für ihn, den Perfektionisten, der immer bis zum Feierabend seine To-do-Liste des Tages abarbeitete. Eine Weile saß er apathisch vor seinem Rechner, dann ging er zum Arzt – und brach in Tränen aus. »Ich war gar nicht mehr zu beruhigen.«
Festgestellt wurden ein Hörsturz – schon zum zweiten Mal– und das Burn-out-Syndrom. Mit seiner Hausärztin besprach Bergmann, ob er sich zu Hause erholen oder in eine Klinik gehen wollte. Er entschied sich, zu Hause zu bleiben, und suchte sich einen Gesprächstherapeuten. Nach ein paar Stunden merkte er, dass er mit ihm nicht zurechtkam. »Er hat mir kaum Rückmeldungen gegeben auf das, was ich ihm erzählt habe, sodass ich keine großen Fortschritte gemacht habe.«
Vier Monate brauchte Bergmann, um überhaupt Abstand zu seiner Arbeit als Finanzdienstleister zu bekommen. »Bis dahin konnte ich nicht schlafen und hatte ein schlechtes Gewissen aus Angst, dass meine Aufgaben im Büro unerledigt bleiben könnten«, erinnert sich Bergmann. »Erst nach dieser Zeit konnte ich mir überhaupt eingestehen, dass es mir nicht gut geht – und dass ich deswegen kein minderwertiger Mensch bin.«
Wie man Burn-out behandelt, ist nicht in Leitlinien festgelegt, das Syndrom ist nicht einmal als Krankheit anerkannt. Therapeuten gehen deshalb unterschiedlich vor. Einig sind sich Psychologen darin, dass zwei Schritte entscheidend sind, damit Betroffene sich dauerhaft erholen: Erstens sollten sie lernen, ihren Umgang mit Stress zu ändern, beispielsweise in einer Verhaltenstherapie oder mithilfe von Entspannungsmethoden. Zweitens ist es notwendig, nach der Rückkehr an den Arbeitsplatz die Belastungen dort zu reduzieren.
Читать дальше