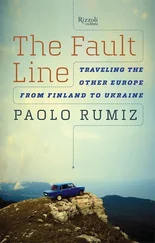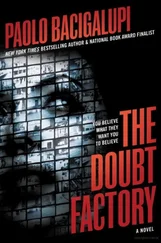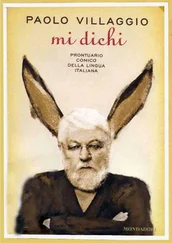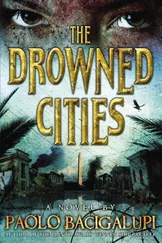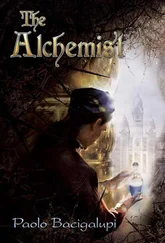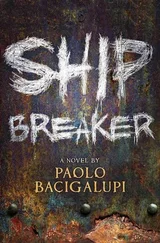Er lässt sie vieles wiederholen, stellt weitere Fragen. Kehrt zu Nebensächlichkeiten zurück, von denen sie glaubte, er hätte sie vergessen. Er ist unbarmherzig, nimmt ihre Geschichte Stück für Stück auseinander, fordert Erklärungen. Er weiß, wie man Fragen formuliert. Gendo-sama hat seine Untergebenen auf diese Art und Weise ausgefragt, wenn er wissen wollte, warum ein Klipper nicht termingerecht fertiggestellt worden war. Er bohrte sich durch Ausreden wie ein genmanipulierter Rüsselkäfer.
Schließlich nickt der Gaijin zufrieden. »Gut«, sagt er. »Sehr gut.«
Emiko verspürt Freude über sein Lob in sich aufwallen und hasst sich zugleich dafür. Der Gaijin trinkt seinen Whisky aus. Greift in die Tasche, zieht ein Bündel Geldscheine hervor und zählt im Aufstehen einen Teil davon ab.
»Die sind für dich, nur für dich. Lass Raleigh nichts davon sehen. Ihn bezahle ich selbst, bevor ich gehe.«
Vermutlich sollte sie ihm dankbar sein, aber sie fühlt sich ausgenutzt. Ebenso ausgenutzt von diesem Mann und seinen Worten wie von allen anderen auch — den heuchlerischen Grahamiten und den Weißhemden des Umweltministeriums, die den Nervenkitzel des Tabubruchs suchen und nach Sex mit einer absonderlichen, unreinen Kreatur gieren.
Sie hält die Geldscheine zwischen den Fingern. Ihre Ausbildung gebietet Höflichkeit, doch die selbstgerechte Großzügigkeit des Gaijin ärgert sie.
»Was, glaubt der Gentleman, werde ich mit diesen Baht tun?«, fragt sie. »Soll ich mir hübschen Schmuck kaufen? Mich selbst zum Abendessen einladen? Ich gehöre mir nicht. Ich bin Raleighs Eigentum.« Sie wirft ihm das Geld vor die Füße. »Es spielt keine Rolle, ob ich reich bin oder arm. Ich bin eine Sklavin.«
Der Fremde hält inne, eine Hand auf der Schiebetür. »Warum läufst du dann nicht weg?«
»Wohin? Meine Importgenehmigung ist abgelaufen.« Sie lächelt verbittert. »Ohne den Schutz und die Verbindungen von Raleigh-san würden mich die Weißhemden kompostieren.«
»Du könntest in den Norden fliehen«, erwidert der Fremde. »Zu den anderen Aufziehmenschen.«
»Was für andere Aufziehmenschen?«
Der Fremde lächelt. »Raleigh hat dir nichts von ihnen erzählt? Von den Enklaven der Aufziehmenschen in den Bergen? Von den Flüchtlingen aus dem Kohlekrieg? Den Freigelassenen? «
Als er ihr ausdrucksloses Gesicht sieht, fährt er fort: »Dort oben gibt es ganze Dörfer, die vom Dschungel leben. Das Land ist arm und von Genhackern fast vollständig zerstört. Es liegt hinter Chiang Rai, jenseits des Mekong. Aber die Aufziehmenschen dort haben keine Patrone, und sie gehören auch niemandem. Der Kohlekrieg tobt noch immer, aber wenn du deine Nische so sehr hasst, ist es eine Alternative zu Raleigh.«
»Stimmt das?« Sie beugt sich vor. »Diese Dörfer, gibt es die wirklich?«
Der Fremde lächelt erneut. »Du kannst Raleigh fragen, wenn du mir nicht glaubst. Er hat sie mit eigenen Augen gesehen. « Er hält inne. »Allerdings wird er keinen Vorteil darin sehen, dir davon zu erzählen. Sonst kommst du noch auf die Idee, deine Ketten abzustreifen.«
»Sagen Sie mir auch die Wahrheit?«
Der blasse Mann tippt sich mit dem Finger an den Hut. »Wenigstens so sehr, wie du mir die Wahrheit gesagt hast.« Er schiebt die Tür auf und schlüpft hindurch. Emiko bleibt alleine zurück, mit pochendem Herzen und dem plötzlichen Willen zu leben.
»500, 1000, 5000, 7500 …«
Das Königreich vor allen Infektionen der Natur beschützen zu wollen, gleicht dem Versuch, den Ozean in einem Netz zu fangen. Eine gewisse Anzahl von Fischen mag man erwischen, aber der Ozean ist ewig und strömt durch die Maschen.
»10 000, 12 500, 15 000 … 25 000 …«
Hauptmann Jaidee Rojjanasukchai ist sich dessen mehr als bewusst, wie er da mitten in der schwülheißen Nacht unter dem gewaltigen Rumpf des Luftschiffs der Farang steht. Über ihm drehen sich surrend die Turbopropeller. Die Fracht liegt verstreut auf dem Flugfeld, die Kisten aufgebrochen, der Inhalt über den ganzen Ankerplatz verteilt, als hätte ein Kind mit seinem Spielzeug um sich geworfen. Verschiedenste Kostbarkeiten und verbotene Ware.
»30 000, 35 000 … 50 000 …«
Um ihn herum erstreckt sich der frisch renovierte Flugplatz von Bangkok, der von an Spiegeltürmen montierten Hochleistungs-Methanlampen erleuchtet wird: Auf der riesigen, in grünes Licht getauchten Freifläche reihen sich die Ankerplätze aneinander; darüber schweben die gewaltigen Ballons der Farang. An den Rändern soll der dichte Bestand von HiGro-Bambus und gesponnenem Stacheldraht die internationalen Grenzen markieren.
» 60 000, 70 000, 80 000 …«
Das Königreich Thailand wird verschlungen. Jaidee lässt müßig den Blick über die Verwüstung schweifen, die seine Leute angerichtet haben — es ist nicht zu übersehen. Sie werden vom Ozean verschlungen. Fast jede Kiste enthält etwas Verdächtiges. Wobei die Kisten nur symbolisch für andere, allgegenwärtige Probleme stehen: In Chatuchak werden Chemikalien-Bäder vom grauen Markt verkauft, und im Dunkel der Nacht staken Männer in ihren Booten den Chao Phraya hinauf, den Rumpf voller Ananasfrüchte der nächsten Generation. Unaufhörlich weht Blütenstaub über die Halbinsel und bringt die neusten Genom-Konstrukte von AgriGen und PurCal mit sich, während die Cheshire fast unsichtbar in den Abfällen der Soi wühlen und Jingjok2-Eidechsen die Eier von Nachtschwalben und Pfauen rauben. Elfenbeinkäfer bohren sich durch die Wälder des Khao Yai, während die Pflanzenwelt und die dicht gedrängten Menschenmassen von Krung Thep von Cibiskose-Zuckern, Rostwelke und der fa’ gan -Wucherung durchseucht werden.
Es ist der Ozean, der all dies mit sich bringt. Der Träger allen Lebens.
»90 … 100 000 … 110 … 125 …«
Große Denker wie Premwadee Srisati und Apichat Kunikorn mögen über die besten Schutzmaßnahmen oder über die Vorteile der UV-Sterilisierung als Barriere entlang der Grenzen des Königreichs im Vergleich zur nächsten Präventivmutation der Genhacker diskutieren, doch das sind Jaidees Ansicht nach alles Idealisten. Der Ozean findet immer einen Weg.
»126 … 127 … 128 … 129 …«
Jaidee beugt sich über die Schulter von Leutnant Kanya Chirathivat und schaut ihr dabei zu, wie sie die Bestechungsgelder zählt. Zwei Zollinspektoren stehen steif daneben und warten darauf, dass sie ihre Autorität zurückerhalten.
»130 … 140 … 150 …« Kanyas Stimme ist ein gleichmäßiger Sprechgesang. Ein Loblied auf den Reichtum, auf Schmiergelder, auf neue Geschäfte in einem alten Land. Ihre Stimme ist klar und pedantisch. Sie wird sich niemals verzählen.
Jaidee lächelt. Gegen ein kleines Geschenk, das guten Willen zeigt, ist nie etwas einzuwenden.
Auf dem nächsten Ankerplatz zweihundert Meter entfernt brüllen Megodonten, während sie die Ladung aus dem Bauch eines Luftschiffs schleppen und alles aufhäufen, damit es sortiert und vom Zoll überprüft werden kann. Turbopropeller kreisen, um das gewaltige Luftschiff, das über ihnen steht, im Gleichgewicht zu halten. Der Ballon dreht sich und hat Schlagseite. Sandige Böen und Megodonten-Dung fegen über Jaidees Weißhemden, die in Reih und Glied stehen. Kanya legt eine Hand auf die Baht, die sie zählt. Die übrigen Männer warten ungerührt, die Hände auf den Macheten, während der Wind sie umpeitscht.
Der von den Turbopropellern ausgelöste Windstoß lässt nach. Kanya stimmt wieder ihren Gesang an. »160 … 170 … 180 …«
Die Zollbeamten schwitzen. Selbst in dieser heißen Jahreszeit gibt es keinen Grund, so stark zu schwitzen. Jaidee schwitzt nicht. Aber schließlich ist er auch nicht gezwungen, ein zweites Mal Schutzgelder zu entrichten, die vermutlich schon beim ersten Mal äußerst hoch waren.
Читать дальше