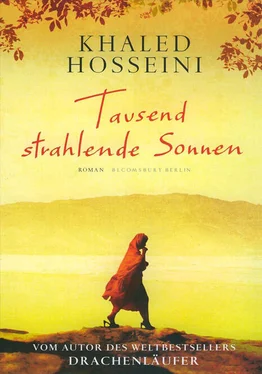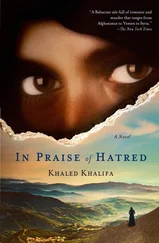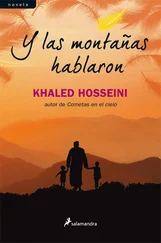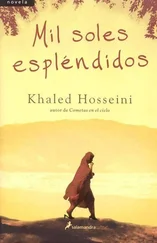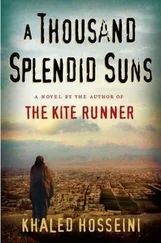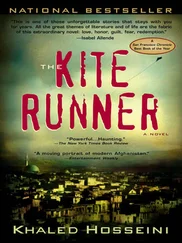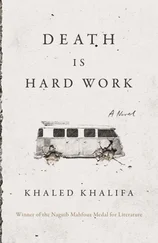Mullah Faizullah gab Mariam gegenüber zu, dass er den Sinn der arabischen Worte im Koran nicht verstehe, wohl aber ihren Klang zu schätzen wisse. Er sagte, sie trösteten ihn und erleichterten sein Herz.
»Auch dich werden sie trösten, Mariam jo«, sagte er. »Du kannst sie aufrufen, wenn du Kummer hast. Und du wirst nicht enttäuscht sein, denn Gottes Worte täuschen nie, mein Mädchen.«
Mullah Faizullah konnte nicht nur gut erzählen, sondern auch zuhören. Wenn Mariam redete, war er immer ganz Ohr. Er wiegte dabei langsam den Kopf, lächelte und zeigte sich so dankbar, als würde ihm ein großes Privileg gewährt. Ihm konnte Mariam bedenkenlos anvertrauen, was sie Nana nicht zu sagen gewagt hätte.
Eines Tages, als sie wieder einmal spazieren gingen, sagte Mariam, dass sie sich wünschte, die Schule besuchen zu dürfen.
»Ich meine eine wirkliche Schule, akhund sahib. In einem Klassenzimmer. Wie auch die anderen Kinder meines Vaters.«
Mullah Faizullah blieb stehen.
Zwei Wochen zuvor hatte Bibi jo berichtet, Jalils Töchter Saideh und Naheed seien von der Mehri-Schule für Mädchen in Herat aufgenommen worden. Seither spukten Bilder von Schulbänken und Lehrern durch Mariams Kopf, Bilder von Heften mit linierten Seiten, Spalten voller Zahlen und Tinte, die dunkle Zeichen auf dem Papier hinterließ. Sie malte sich aus, mit anderen Mädchen ihres Alters in einem Klassenzimmer zu sitzen, und sehnte sich danach, ein Lineal aufs Heft legen und wichtig aussehende Zeilen unterstreichen zu können.
»Ist dir das ein ernster Wunsch?«, fragte Mullah Faizullah und betrachtete sie mit seinen sanften wässrigen Augen. Er hatte die Hände hinter dem krummen Rücken verschränkt, und der Schatten seines Turbans fiel auf einen Flecken leuchtender Butterblumen.
»Ja.«
»Und jetzt willst du, dass ich deine Mutter um Erlaubnis bitte, nicht wahr?«
Mariam lächelte. Außer Jalil gab es, wie sie dachte, keinen Menschen auf der Welt, der sie so gut verstand wie ihr alter Lehrer.
»Was bliebe mir also anderes übrig? Gott in seiner Weisheit hat jedem von uns Schwächen mit auf den Weg gegeben, und die größte meiner vielen Schwächen ist, dass ich dir, Mariam jo, nichts ausschlagen kann«, erwiderte er und tippte ihr mit einem gichtigen Finger auf die Wange.
Doch als er sich später an Nana wandte, ließ diese das Messer fallen, mit dem sie gerade Zwiebeln schnitt, und fragte: »Wozu?«
»Lass das Mädchen lernen, wenn es das möchte. Gib ihr die Chance auf eine Ausbildung, meine Teure.«
»Lernen? Was denn, Mullah sahib?«, entgegnete Nana in scharfem Tonfall. »Was gäbe es da zu lernen?« Sie warf ihrer Tochter einen grimmigen Blick zu.
Mariam schaute zu Boden.
»Was für einen Sinn hätte es, ein Mädchen wie dich zu unterrichten. Genauso gut könnte man einen Spucknapf polieren. Außerdem kann man in diesen Lehranstalten nichts lernen, was von Wert wäre. Es gibt nur eines, was Frauen wie wir in diesem Leben können müssen, und das bekommt man nicht in der Schule beigebracht. Sieh mich an.«
»Du solltest so nicht mit ihr reden, mein Kind«, sagte Mullah Faizullah.
»Sieh mich an!«
Mariam gehorchte.
»Nur eines muss sie können. Und das ist: tahamul. Aushalten.«
»Aushalten? Was denn, Nana?«
»Ach, machen Sie sich mal darüber keine Sorgen«, antwortete Nana. »Da fände sich einiges, und das nicht zu knapp.«
Und dann beschwerte sie sich darüber, von Jalils Frauen als hässliche, armselige Steinmetztochter beschimpft worden zu sein, oder wie man sie gezwungen habe, bei Frost Wäsche zu waschen, bis ihr das Gesicht abgefroren sei und die Fingerspitzen gebrannt hätten.
»Das ist unser Los, Mariam. Das Los von Frauen wie uns. Wir müssen aushalten. Mehr ist nicht drin. Verstanden? Außerdem würden sie dich in der Schule doch nur auslachen. Glaub mir. Sie würden dich einen harami nennen und die hässlichsten Dinge über dich sagen. Das lasse ich nicht zu.«
Mariam nickte.
»Von Schule will ich nichts mehr hören. Du bist alles, was ich habe. Dich will ich nicht an die anderen verlieren. Sieh mich an. Kein Wort mehr über Schule.«
»Sei vernünftig. Ich bitte dich. Wenn ein Mädchen den Wunsch hat…«
»Und Sie, akhund sahib, bei allem Respekt, Sie sollten sich hüten, ihr solche Flausen einzureden. Wenn Ihnen wirklich an ihr gelegen ist, sollten Sie ihr klarmachen, dass sie hierher gehört, zu ihrer Mutter. Da draußen ist nichts für sie zu holen. Nichts außer Ablehnung und Schmerz. Ich weiß, wovon ich spreche, akhund sahib. Ich weiß es.«
Mariam freute sich über jeden Besuch in der kolba , über den Dorf- arbab und seine Geschenke, Bibi jo mit ihren schmerzenden Hüftgelenken und endlosen Klatschgeschichten und natürlich über Mullah Faizullah. Doch es gab niemanden, wirklich niemanden, den Mariam sehnlicher zu sehen wünschte als Jalil.
Schon dienstags abends setzte die Unruhe ein. Mariam konnte kaum einschlafen aus Sorge, dass Jalils Besuch am Donnerstag womöglich aus irgendwelchen geschäftlichen Gründen ausfallen könnte und sie eine weitere Woche würde warten müssen, bis sie ihn endlich wiedersähe. Mittwochs konnte sie keinen Moment lang stillsitzen; sie marschierte um die kolba herum, warf wahllos Hühnerfutter ins Gehege, streunte umher, zupfte Blütenblätter und schlug nach den Mücken, die ihr in die Arme zu stechen versuchten. Donnerstags endlich hockte sie schon morgens vor der Tür, die Augen unverwandt auf die Furt gerichtet, und wartete. Wenn sich Jalil verspätete, bekam sie es mit der Angst zu tun. Dann wurden ihr die Knie weich, und sie musste sich flach auf den Boden legen.
Schließlich würde Nana rufen: »Da ist er ja, dein Vater. In all seiner Herrlichkeit.«
Wenn sie ihn, lachend und überschwänglich winkend, über die Steine im Fluss hüpfen sah, sprang Mariam vom Boden auf. Sie wusste, dass Nana ein Auge auf sie hatte und jede ihrer Regungen ganz genau beobachtete, und es kostete sie immer viel Überwindung, in der Tür stehen zu bleiben, zu warten, anstatt auf ihn zuzulaufen. Sie hielt sich zurück und blickte ihm geduldig entgegen, wenn er, die Anzugjacke über die Schulter geworfen, durch das hohe Gras schritt und seine rote Krawatte im Wind flatterte.
Wenn Jalil die Lichtung erreichte, warf er seine Jacke auf den tandoor und breitete die Arme aus. Mariam ging auf ihn zu, zuerst langsam, dann im Laufschritt. Er fing sie unter den Achseln auf und warf sie hoch in die Luft. Mariam quietschte dann vor Vergnügen.
Gestützt von seinen Armen, blickte sie ihm von oben ins emporgewandte Gesicht mit seinem breiten verschmitzten Lächeln, dem spitzen Haaransatz und dem Grübchen im Kinn. Sie mochte seinen sorgfältig gestutzten Schnauzbart, und es gefiel ihr, dass er bei jedem Wetter einen Anzug trug — dunkelbraun, seine Lieblingsfarbe, mit einem weißen dreieckig gefalteten Taschentuch in der Brusttasche —, auch Manschettenknöpfe und eine Krawatte, meist rot, die immer ein bisschen gelockert war. Mariam sah sich dann auch selbst, gespiegelt in seinen braunen Augen: das sich bauschende Haar, ein vor Glück strahlendes Gesicht und den Himmel im Rücken.
Nana sagte, dass sie ihm eines Tages, wenn er sie verfehlte, aus den Händen gleiten, zu Boden stürzen und sich einen Knochen brechen würde. Doch dass er sie fallen lassen könnte, mochte Mariam nicht glauben. Vielmehr war sie überzeugt davon, dass sie in den sauberen, gepflegten Händen ihres Vaters immer sicher landen würde.
Sie saßen im Schatten vor der kolba. Nana servierte Tee. Sie und Jalil tauschten zur Begrüßung allenfalls ein befangenes Lächeln aus und nickten mit dem Kopf. Darauf, dass sie seine Kinder mit Steinen bewarf und verfluchte, kam er nie zu sprechen.
Читать дальше