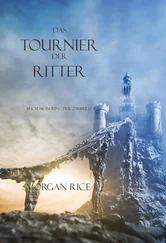Thanos stand auf. Er hatte es satt, vor diesem Mann zu knien. „Ich habe es verstanden, Vater. Ich habe dich bestens verstanden.“
Er drehte sich um und lief auf die Türen zu ohne auf eine Erlaubnis zu warten. Was konnte sein Vater schon tun? Es würde ihn schwach aussehen lassen, wenn er ihn zurückriefe. Thanos trat durch die Tür, wo Stephania auf ihn wartete. Es sah so aus, als hätte sie ihre Selbstbeherrschung zum Wohle der Leibgarde bewahrt, doch in dem Moment als Thanos durch die Tür kam, lief sie auf ihn zu.
„Geht es dir gut?“ fragte Stephania und hob eine Hand an seine Wange. Sie ließ sie weiter nach unten fahren und Thanos sah, dass Blut an ihrer Hand haftete als sie sie zurückzog. „Thanos, du blutest!“
„Es ist nur ein Kratzer“, versicherte Thanos ihr. „Das muss noch von dem Kampf vorhin sein,“
„Was ist dort drinnen geschehen?“, fragte sie.
Thanos zwang sich zu einem Lächeln, aber es gelang ihm nicht recht. „Seine Majestät hat sich dazu entschlossen, mich daran zu erinnern, dass Lucious, obwohl wir beide Prinzen sind, ihm wichtiger ist als ich.“
Stephania legte ihre Hände auf seine Schultern. „Ich habe dir gesagt, Thanos. Es war nicht der richtige Zeitpunkt. Du darfst dich nicht so in Gefahr bringen. Du musst mir versprechen, mir zu vertrauen und nie wieder so etwas Dummes zu tun. Versprich es mir.“
Er nickte.
„Weil du es bist, meine Liebe, werde ich es dir versprechen.“
Sein Versprechen war aufrichtig. Lucious so offen anzugreifen war nicht die richtige Strategie, denn es erzielte nicht die gewünschte Wirkung. Lucious war gar nicht das Problem. Das gesamte Reich war das Problem. Für einen kurzen Augenblick hatte er geglaubt, den König überzeugen zu können, die Dinge anders anzugehen, doch in Wahrheit wollte sein Vater gar nicht, dass sie sich änderten.
Nein, der einzig wahre Weg der ihm jetzt noch blieb, war, die Rebellion zu unterstützen. Nicht nur die Rebellen auf Haylon, alle von ihnen. Allein konnte Thanos nicht viel bewirken, doch zusammen, könnte es ihnen gelingen, das Reich zu stürzen.
Wo sie auch hinsah, überall erblickte Ceres auf der Insel jenseits des Nebels Dinge von einer seltsamen Schönheit, die sie innehalten und staunen ließen. Falken, deren Federn in allen Regenbogenfarben schimmerten, kreisten auf der Suche nach Beute über ihr und waren doch gleichzeitig die Gejagten einer beflügelten Schlange, die sich schließlich auf einem Türmchen aus weißem Marmor niederließ.
Sie lief über das smaragdgrüne Gras der Insel und es kam ihr vor, als wüsste sie genau, wohin sie gehen musste. Sie hatte sich selbst in der Vision gesehen, dort auf dem Hügel in der Ferne, wo regenbogenfarbene Türme wie die Stacheln eines großen Ungeheuers in die Höhe ragten.
Blumen wuchsen auf dem Hang und Ceres griff nach ihnen, um sie zu berühren. Doch als ihre Finger sie streiften, waren ihre Blätter aus papierdünnem Stein. Hatte jemand sie so fein gemeißelt oder lebte der Stein etwa? Die Tatsache, dass sie sich so etwas vorstellen konnte, zeigte bereits, wie seltsam dieser Ort war.
Ceres lief weiter auf die Stelle zu, von der sie wusste oder hoffte, dass ihre Mutter dort wartete.
Sie erreichte den Fuß des Hügels und begann hinaufzusteigen. Die Insel um sie war voller Leben. Bienen summten im niedrigen Gras. Eine rehgleiche Kreatur, die Kristallzacken hatte wo man Fühler vermutet hätte, blickte Ceres lange an bevor sie davonsprang.
Doch hatte sie trotz der Häuser, die wie Punkte die Landschaft schmückten, noch immer keine Menschen gesehen. Die Häuser, die Ceres am nächsten waren, wirkten leer und unberührt, wie ein Raum, der nur vor wenigen Augenblicken verlassen worden war. Ceres ging weiter gen Spitze des Hügels, dorthin, wo die Türme auf einem großen Rasen einen Kreis bildeten. Sie konnte zwischen ihnen hindurch über die ganze restliche Insel blicken.
Doch sie blickte nicht in diese Richtung. Ceres starrte vielmehr auf die Mitte des Kreises, wo eine Figur in einem Kleid aus reinem Weiß stand. Die Figur war nicht wie in ihrer Vision verschwommen oder verwackelt. Sie war dort, so klar und echt wie sie selbst hier war. Ceres ging auf die Person zu. Es konnte nur sie sein.
„Mutter?“
„Ceres.“
Die Figur in weiß warf sich im selben Moment wie Ceres nach vorne und sie trafen sich in einer gewaltigen Umarmung, die für Ceres all die Dinge ausdrückte, die sie nicht zu sagen vermochte: wie sehr sie sich nach diesem Moment gesehnt hatte, wie viel Liebe dort in ihr war, wie unglaublich es war, diese Frau zu treffen, die sie nur einmal in einer Vision gesehen hatte.
„Ich wusste, dass du kommen würdest“, sagte die Frau, ihre Mutter als sie sich voneinander lösten, „aber es zu wissen unterscheidet sich dann doch sehr davon, dich wirklich zu sehen.“
Sie zog die Kapuze ihres Kleides zurück und Ceres musste sich verblüfft fragen, wie diese Frau ihre Mutter sein konnte. Ihre Schwester vielleicht, denn sie hatten das gleiche Haar und die gleichen Gesichtszüge. Es war für Ceres beinahe wie ein Blick in den Spiegel. Doch schien sie zu jung, um Ceres’ Mutter sein zu können.
„Ich verstehe nicht“, sagte Ceres. „Du bist meine Mutter?“
„Das bin ich.“ Sie beugte sich nach vorne, um sie erneut zu umarmen. „Ich weiß, dass es dir seltsam erscheinen muss, aber es ist wahr. Meine Art kann eine lange Zeit leben. Ich bin Lycine.“
Ein Name. Endlich kannte Ceres den Namen ihrer Mutter. Das bedeutete ihr mehr als alles zusammengenommen. Das allein war es wert, diese Reise unternommen zu haben. Sie wollte einfach nur dastehen und ihre Mutter für immer anstarren. Auch wenn sie Fragen hatte. So viele, dass sie nur so aus ihr heraussprudelten.
„Was ist dieser Ort?“ fragte sie. „Warum bist du allein hier? Und warte, was meinst du mit ‚deiner Art’?“
Lycine lächelte und setzte sich in das Gras. Ceres setzte sich zu ihr und als sie das tat, bemerkte sie, dass es nicht einfach nur Gras war. Sie konnte die in einem Mosaik angeordneten Steinfragmente unter dem Gras sehen. Sie mussten schon lange von der Wiese bedeckt sein.
„Es ist nicht einfach, alle deine Frage zu beantworten“, sagte Lycine. „Vor allem, wenn ich selbst so viele Fragen habe, zu dir, deinem Leben. Alles, Ceres. Aber ich werde es versuchen. Sollen wir es auf die alte Art versuchen? Jeder eine Frage abwechselnd?“
Ceres wusste nicht, was sie darauf sagen sollte, doch ihre Mutter schien noch nicht fertig zu sein.
„Erzählen sie dort draußen immer noch die Geschichten der Uralten?“
„Ja“, sagte Ceres. Sie hatten den Geschichten über die Kampfherrn und ihre Unternehmungen im Stadion immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt, doch wusste sie dennoch einiges über das, was man über die Uralten sagte: diejenigen, die schon vor Anbeginn der Menschheit existiert hatten, die manchmal wie Menschen aussahen und manchmal doch so anders. Die so viel aufgebaut hatten und es dann verloren hatten. „Warte, meinst du damit, dass du – “
„Eine der Uralten bist, ja“, antwortete Lycine. „Das hier war einst eine unserer Stätten bevor... nun, es gibt noch immer Dinge, über die man besser nicht sprechen sollte. Außerdem schuldest du mir eine Antwort. Erzähl mir, wie dein Leben ausgesehen hat. Ich konnte nicht da sein, aber ich habe viel Zeit damit verbracht, es mir vorzustellen.“
Ceres wollte es versuchen, wenn sie auch nicht wusste, wo sie anfangen sollte. Sie erzählte Lycine von der Schmiede ihres Vaters, in der sie aufgewachsen war und von ihren Brüdern. Sie sprach von der Rebellion und vom Stadion. Sie schaffte es sogar über Rexus und Thanos zu berichten, auch wenn ihr die Worte nur heiser und bruchstückhaft über die Lippen kamen.
„Mein Liebling“, sagte ihre Mutter und legte eine Hand auf die ihre. „Ich wünschte, ich hätte dir diesen Schmerz ersparen können. Ich wünschte, ich hätte für dich da sein können.“
Читать дальше