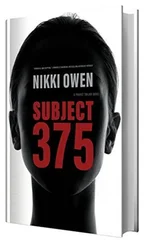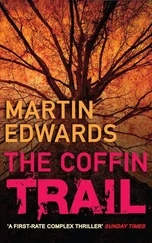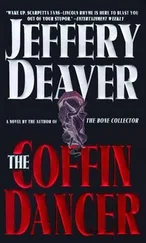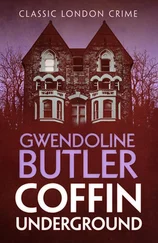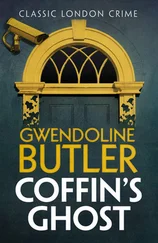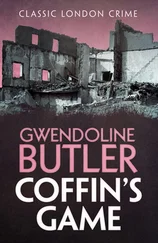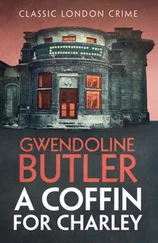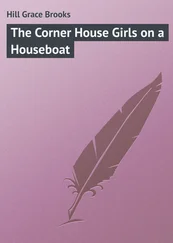In unseren Coachings konfrontieren wir Führungskräfte und Mitarbeiter regelmäßig mit dem Menschen hinter der Arbeitskraft. Spannend! Bei der Übung Leading self darf jeder eine individuelle Lebenslinie zeichnen, die in verschiedene Kategorien aufgeteilt wird. So ergeben sich Erkenntnisse, die sich auf die jeweilige Persönlichkeit beziehen. Die anderen erhalten dabei beispielsweise einen Einblick, wo der Einzelne seine Stärken und Schwächen sieht, was er/sie im Leben erreichen will oder worin er den Sinn seines Daseins sieht.
Das Resultat ist beachtlich: Manche Führungskräfte kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus, dass sie seit zehn Jahren oder mehr mit Menschen zusammensitzen, über die sie wenig bis gar nichts wussten. Und glauben Sie mir: Wenn Sie als Führungskraft einen Mitarbeiter auch als Menschen kennen, treffen Sie andere Entscheidungen! Umgekehrt gilt natürlich dasselbe. Das ist so einfach – sobald beiden Parteien erst einmal bewusst ist, welche Werte einen gemeinsamen Nenner darstellen!
Es ist nunmal so: Niemand vertraut einer Arbeitskraft. Niemand vertraut einem Management. Niemand vertraut dem Personal oder dem Humankapital. Aber Menschen vertrauen Sie! Vertrauen ist der Anfang von allem. Doch das kann nur entstehen, wenn Menschen sich kennen.
Der Erfolg von Leading self ergibt sich meines Erachtens daraus, dass Menschen sich berührt fühlen, weil sie zum ersten Mal nicht nur als ausführende Organe, als Rädchen im Getriebe gesehen werden, sondern als beseelte Individuen. Es ist nicht nötig, sich gegenseitig die privatesten Geheimnisse zu entlocken, alleine schon einige Anhaltspunkte darüber, wer dein Gegenüber ist, schaffen Berührungspunkte, die sinnbehaftet sind, weil sie individuelle und gemeinsame Werte offenbaren.
Wie auch wollen Sie den Sinn eines Unternehmens und den Sinn eines Menschen zusammenbringen, wenn Sie vorher den Sinn des Menschen nicht kennen?
Gerade heute, wo es so schwer ist, gute Leute zu finden und auch zu halten: In Märkten, die sich stark verändern, verlieren Unternehmen ihre besten Mitarbeiter oftmals schon nach zwei Jahren. Da braucht es schon ein hohes Maß an Überzeugungskraft und Kreativität, um immer wieder neue Kräfte einzubauen. Unternehmen, die es schaffen, schnell Beziehungen aufzubauen und Vertrauen zu bilden, sind klar im Vorteil.
Ich kann mich an einen Praktikanten erinnern, der Spitzenarbeit geleistet hat. Er war ohne jede Übertreibung einfach top. Kurz vor Ende seines Praktikums fragte ich ihn, ob er nicht gerne bei uns bleiben würde.
Seine klare Antwort: »I don’t feel the urge to hire a boss.« (Etwa: »Mich drängt es nicht dazu, einen Chef einzustellen.«)
Das musste ich schlucken. Einerseits fand ich das furchtbar schade, andererseits freute ich mich für ihn. Inzwischen hat dieser ehemalige Praktikant mehrere Unternehmen gegründet und ist jetzt Angel Investor. Fantastisch!
Der Punkt ist: Viele junge Leute stellen sich die Beziehung zwischen Chef und Mitarbeitern völlig anders vor als die vorherige Generation. Anweisungen entgegenzunehmen und den reinen Befehlsempfänger zu spielen, haben sie nicht nötig. Gerade die Vertreter der jüngeren Generation wollen als Menschen gesehen und akzeptiert werden. Sie erwarten, dass Führungskräfte mit ihnen auf Augenhöhe kommunizieren. Sie sind viel empfänglicher für eine emotionale Verbindung zu ihren Chefs, als es ihre Kollegen zwanzig oder dreißig Jahre früher waren.
Eines können Sie mir glauben: John Wayne hat damit ein Problem!
Lieber einsam als gemeinsam
Ein anderer Bereich, in dem sich das arrogante Verhalten vieler Unternehmen beobachten lässt, ist der Wettbewerb. Im Rahmen einer Learning journey nach Indien fiel mir auf, dass die Mitarbeiter des französischen Stahlkonzerns, die ich als Beraterin begleitete, schier aus ihren Schuhen gekippt sind, als sie sahen, wie hocheffizient der indische Betrieb funktionierte.
»Das ist ja tausendmal besser als das, was wir haben!«
»Die strafen unsere gesamte Prozessoptimierung Lügen!«
»Super organisiert – das hätte ich nie gedacht!«
Ihre Vorurteile zerbröselten innerhalb nur eines einzigen Tages – und übrig blieb die Angst, den Anschluss im Weltmarkt vielleicht schon längst verpasst zu haben.
Die Konkurrenz zu unterschätzen, ist typisch für Unternehmen, die nach den Methoden des 20. Jahrhunderts geführt werden. Selbst wenn die Entscheidungsträger Reisen ins Ausland unternehmen, um den Betriebsablauf anderer Unternehmen aus derselben Branche kennenzulernen, setzen sie sich meistens doch nur marginal mit den konkreten Arbeitsmodalitäten auseinander.
Ich glaube, der durchschnittliche John Wayne an der Spitze einer Unternehmenspyramide hat es verlernt, Fragen zu stellen. Er glaubt es nicht nötig zu haben, Dinge hinzuzulernen, nach dem Motto: »Kenne ich alles, habe ich alles schon gesehen, brauche ich mir nicht zu geben.« Er sieht seinen Betrieb als ein abgeschottetes Ökosystem, das schon immer so funktioniert hat, wie es heute funktioniert. Fähigkeit und Interesse, sich für Neues zu öffnen und in bestimmten Märkten nicht auf reine Competition, sondern auf »Coopetition« zu setzen, geht ihm komplett ab. Und zwar grundsätzlich.
Coopetition, das bedeutet sinngemäß: Kooperationswettbewerb. Also mit den Wettbewerbern in bestimmten Feldern gemeinsame Sache zu machen. So könnten beispielswiese eine Volksbank und eine Sparkasse eine große Kreditvergabe eines lokal ansässigen Mittelständlers gemeinsam stemmen. Für eine Bank alleine wäre das Geschäft zu groß, aber gemeinsam mit einem Konsortialkredit würde das gehen. Das einzige Hindernis ist das Denken und die Haltung: Mit dem größten Wettbewerber gemeinsam an einem Tisch sitzen? Wo kämen wir denn da hin?!
Fakt ist aber: Durch Coopetition lassen sich gemeinsam Produkte oder Standards entwickeln, die sonst nicht finanzierbar wären oder die sich für einen Anbieter alleine nicht lohnen würden. Am Ende gewinnen alle.
Und genau das ist das Problem: In der John-Wayne-Weltsicht muss es immer einen Gewinner und einen Verlierer geben. Ein Szenario mit mehreren Gewinnern fühlt sich da nicht wie ein Erfolg an …
Dem typischen John-Wayne-Unternehmer fehlt in aller Regel der Open mind , den er bräuchte, um über seinen Schatten zu springen. Wenn er an so etwas wie Kooperationswettbewerb überhaupt denkt.
Der letzte Bereich – in dem nach meiner Erfahrung mit das höchste Maß an Arroganz herrscht – ist der Umgang mit Lieferanten. Die wenigsten Unternehmen haben auch nur das geringste Interesse daran, das Potenzial zu nutzen, welches ihnen durch seine Lieferanten auf dem Silbertablett präsentiert wird. Dieses Potenzial besteht in der großen Nähe zum Markt, zu den Kunden, zu der Welt da draußen. Lieferanten sind dieser Welt viel näher als beispielsweise der Vertrieb!
Doch das interessiert den John Wayne an der Spitze der Pyramide nicht – vielleicht weil er Angst um seinen Status hat. Er könnte ja einen Teil seiner Macht einbüßen, wenn ihm jemand klarmacht, dass seine Planungen nicht das Geringste mit dem zu tun haben, was außerhalb seines Büros in der Welt passiert. Außerdem: Ganz automatisch sehen sich viele Führungskräfte unbewusst und unwillkürlich vom Selbverständnis her auf einer höheren Stufe als der Lieferant: Der Lieferant ist aus irgendeinem irrationalen Grund nicht auf Augenhöhe, sondern es wird vom Hochstatus aus auf ihn herabgesehen – und so behandelt man ihn dann auch. Der Lieferant ist kein Partner, der offen empfangen wird, sondern einer, der eben im übertragenen Sinne den Lieferanteneingang nehmen muss. Das ist heute auch nicht anders als vor hundert Jahren.
Lassen Sie mich die Bereiche, in denen die Arroganz besonders spürbar ist, noch einmal kurz zusammenfassen:
Читать дальше