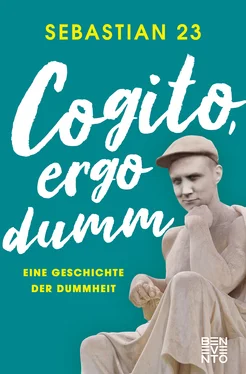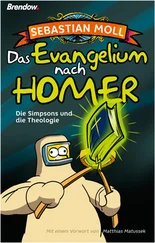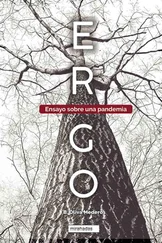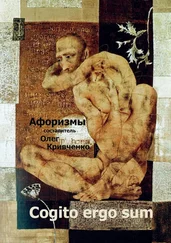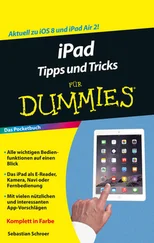Immer wieder beeindruckt zeigen sich die Menschen auch von Kopfrechenkünstler*innen. Die gelten als überaus intelligent, wenn sie mal eben beim Frühstück zwischen Scheiblettenkäse und Mirabellenmarmelade dreistellige Zahlen im Kopf multiplizieren. Das kann ich übrigens auch, vorausgesetzt, die dreistelligen Zahlen sind 100 und 100. Da ist die Lösung einfach: 200. Wäre jedoch allein Kopfrechnen der Maßstab für Intelligenz, dann wäre bereits mein Taschenrechner eine übermenschliche künstliche Intelligenz, die uns alle unterjochen könnte: »Kniet nieder, ihr Narren, Fürst Casio X34 ist im Haus und jongliert lässig mit Zweierpotenzen!«
Glücklicherweise ist das nicht so und nur deshalb sind wir noch die überlegene Intelligenz auf diesem Planeten. Vor lauter Freude darüber nennen wir uns selbst Homo sapiens (etwa: der kluge Mensch), bis in die 1990er war sogar die Bezeichnung Homo sapiens sapiens verbreitet. Der kluge, kluge Mensch – das war unser Name. Mag sein, dass wir unser Recht als Erfinder der Sprache, alles zu benennen, da etwas zu unseren Gunsten verbogen haben: »Okay, du bist ein Huhn, du bist eine Katze und du bist ein Dorsch. So, haben jetzt alle Namen? Nein, ich selbst noch nicht? Okay, ich heiße der kluge, kluge Mensch. Hat jemand Einwände? Nein? Okay.«
Kann es da verwundern, dass niemand dumm sein will? Schließlich definieren wir nicht weniger als unsere eigene Gattung über unsere Klugheit. Und doch scheint die Dummheit unser steter Begleiter zu sein. Falls Sie heute noch nichts Dummes gemacht haben, sind Sie vielleicht einfach nicht ehrlich zu sich selbst. Schade im Grunde, dass man nur den IQ messen kann, aber nicht den Dummheitsquotienten, also quasi den SQ, wie man international abkürzen würde. So klagt Emil Kowalski in seinem hervorragenden Buch Dummheit. Eine Erfolgsgeschichte . Über diesen Punkt musste ich allerdings ein wenig schmunzeln. Denn den Dummheitsquotienten zu messen statt den Intelligenzquotienten ist ein wenig, wie die Dunkelheit statt der Helligkeit zu messen: »Ja, Herr Nachtigaller, wir wissen, wie hell es in diesem Raum ist. Aber die Frage bleibt: Wie dunkel ist es in diesem Raum?«
Es lohnt sich also doppelt, in diesem Buch einen genaueren Blick auf die Dummheit zu werfen. Denn die Reise geht immer auch an die Grenzen unserer Intelligenz. Und da wird es erfahrungsgemäß lustig. Ganz nebenbei finden wir vielleicht auch noch raus, ob wir den Ehrentitel Homo sapiens überhaupt verdienen oder in Zukunft eher Homo stultus heißen sollten.
Eine sehr naheliegende Methode, über die Intelligenz oder eben die Dummheit eines Menschen eine Aussage zu treffen, ist der IQ-Test. Der Franzose Alfred Binet erfand das Konzept von Testaufgaben in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Der deutsche Psychologe William Stern entwickelte 1912 aus diesem Test eine Maßeinheit: den Intelligenzquotienten, kurz IQ. Bei Leuten, die vorher gelebt haben oder einen solchen Test nie gemacht haben, kann man nur Mutmaßungen anstellen. Das gilt auch für Albert Einstein, dem ein IQ von 160 nachgesagt wird, der aber nie einen Test gemacht hat, also in Wirklichkeit überhaupt gar keinen IQ hatte. Und das, obwohl er 100 Prozent seines Gehirns nutzte. Ebenso wenig wissen wir über den IQ von Charles King, der 1927 die Präsidentschaftswahlen in Liberia mit 243 000 Stimmen Vorsprung gewann. Beeindruckende Zahlen, besonders bei nur 15 000 Wahlberechtigten im Land. Sein IQ war bestimmt mindestens fünf Milliarden. Aber dazu später mehr.
Die heute gebräuchlichen weiterentwickelten IQ-Tests gehen auf den US-Psychologen David Wechsler zurück. Wir haben uns inzwischen darauf geeinigt, dass alle zwischen 85 und 115 in der Norm liegen. Ab einem IQ von weniger als 70 spricht man von Intelligenzminderung, Minderbegabung, Schwachsinn oder Oligophrenie. »Etwa 5 Prozent der Gesamtbevölkerung weisen nach der psychologischen Definition eine Intelligenzminderung auf«, schreibt der Hirnforscher Ernst Pöppel. Der IQ-Test wird dabei übrigens regelmäßig normiert, dazu werden 30 000 bis 50 000 Probanden gemessen und ein Mittelwert gefunden, der dann als 100 definiert wird. Und es mag Sie vielleicht überraschen, dieser Mittelwert steigt stetig. Nach der Definition von Intelligenztests wird die Menschheit also scheinbar immer klüger. Spätestens dieses Phänomen, das in der Fachwelt als Flynn-Effekt bezeichnet wird, macht mich persönlich ja misstrauisch.
Vielleicht hat der Journalist Bob Fenster das Problem ganz gut eingegrenzt: »Intelligenz wird von Leuten eingeschätzt, die ein berechtigtes Interesse daran haben, Intelligenz hoch einzuschätzen. Sie ist nämlich ihr einziges Ass im Ärmel.« Vielleicht denken Sie jetzt auch: Moment mal, ist das schon alles, was sich im menschlichen Denken abspielt? Nun, machen Sie sich auf ein paar Überraschungen gefasst. Zum Beispiel, dass Ihr gerade geäußerter Gedanke eine kritische Rückfrage ist und damit ein Zeichen für eine Form von Intelligenz, die so in IQ-Tests eben nicht gemessen wird. Nicht dass IQ-Tests deswegen dumm wären. Aber womöglich sind wir nicht so doof, wie mancher IQ-Test uns nahelegen will.
Das Volk der Luo im westlichen Kenia hat in seiner Sprache DhoLuo vier verschiedene Worte für Intelligenz: Rieko, Luoro, Winjo und Paro. Dabei entspricht nur Rieko derjenigen Intelligenz, die in IQ-Tests abgefragt wird, denn mit Rieko bezeichnen die Luo kognitive Kompetenz. Wie Professor Elias Mpofu von der Universität Johannesburg erklärt, bezieht sich Paro auf eine Art kreative Intelligenz und das Durchhaltevermögen bei der Umsetzung von Ideen. Bei Luoro und Winjo handelt es sich hingegen um soziale Fähigkeiten: Die Fähigkeit, andere zu respektieren und sich um sie zu kümmern, wird Luoro genannt, in Abgrenzung dazu bezeichnet Winjo das Verständnis und die Ehrerbietung für Erwachsene, Ältere oder Autoritätsfiguren. Auch in der westlichen Psychologie wird seit geraumer Zeit die emotionale Intelligenz und die damit zusammenhängende Sozialkompetenz diskutiert. Insbesondere der amerikanische Psychologe Daniel Goleman hat 1995 mit seinem Buch Emotional Intelligence. Why It Can Matter More Than IQ das Thema einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. Darin prägt er auch das Gegenmodell zum IQ, nämlich den EQ, mit dem man die Emotionale Intelligenz messen kann.
Robert Sternberg, ebenfalls Psychologe, ging sogar noch einen Schritt weiter und entwickelte ein dreigeteiltes Konzept von Intelligenz: Analytische Intelligenz, Kreative Intelligenz, die bei ihm die Fähigkeit zur Auseinandersetzung mit neuen und ungewohnten Problemen ist, und Praktische Intelligenz, also die Anpassungsfähigkeit an Alltagsprobleme. Seitdem hat er sich der Erforschung und Publikation der Intelligenz und ihrer Grenzen hinter IQ und EQ gewidmet. Erfolg kann man im Leben nur haben, so seine These, wenn man eben auch Praktische und Kreative Intelligenz hat. Praktische Dummheit im Alltag ist dann vermutlich, wenn man morgens um 6:30 Uhr aufsteht, duscht, sich anzieht, Kaffee trinkt und frühstückt, zur Arbeit fährt und pünktlich um 7:59 Uhr vor der Bürotür merkt: Es ist Sonntag. Kreative Dummheit hingegen wäre es, dann seinen Kalender wegen unterlassener Hilfeleistung zu verklagen. Sie sehen, man kann auf ebenso viele Weisen dumm sein, wie man sich intelligent verhalten kann – beruhigend, oder? Die Luo würden sicher zustimmen: Um im Leben zurechtzukommen, braucht man eben mehr als nur Rieko. Und wissen Sie, wer noch zugestimmt hätte? Albert Einstein. Der hat tatsächlich mal – diesmal wirklich ehrlich – in einem Beitrag in der The Saturday Evening Post geschrieben: »Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.«
Da wir hier im Buch einiges dumm nennen werden, möchte ich einen wichtigen Einwand von Emil Kowalski nicht unerwähnt lassen: »Es sei ausdrücklich betont, dass wir physiologisch oder sozial bedingte Mängel an Intelligenz nicht als ›dumm‹ verstehen wollen, also keine Demenz oder andere krankhafte kognitive Störungen, und auch nicht gesellschaftlich bedingte Wissensdefizite. Menschen, die wegen Verletzung, Krankheit oder Alter ihre geistige Beweglichkeit einbüßen oder unter sozial unwürdigen Verhältnissen leben, sind nicht dumm im Sinne unserer Überlegungen. Sie verdienen keinen unserer Sarkasmen, sondern Hilfe und Verständnis.«
Читать дальше