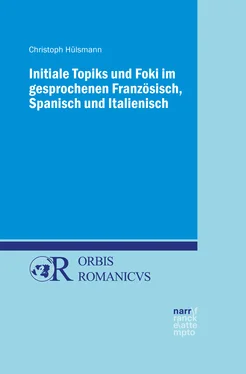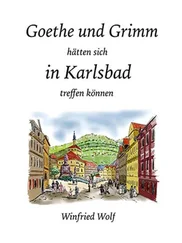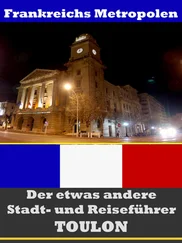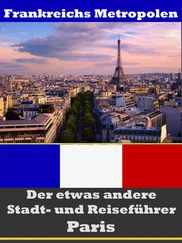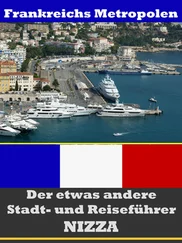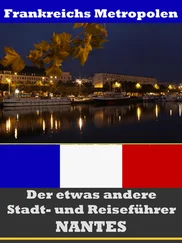Christoph Hülsmann - Initiale Topiks und Foki im gesprochenen Französisch, Spanisch und Italienisch
Здесь есть возможность читать онлайн «Christoph Hülsmann - Initiale Topiks und Foki im gesprochenen Französisch, Spanisch und Italienisch» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Initiale Topiks und Foki im gesprochenen Französisch, Spanisch und Italienisch
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Initiale Topiks und Foki im gesprochenen Französisch, Spanisch und Italienisch: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Initiale Topiks und Foki im gesprochenen Französisch, Spanisch und Italienisch»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Initiale Topiks und Foki im gesprochenen Französisch, Spanisch und Italienisch — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Initiale Topiks und Foki im gesprochenen Französisch, Spanisch und Italienisch», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Das Interesse an informationsstrukturellen Fragestellungen ist in der Linguistik bereits seit längerer Zeit ausgeprägt. Die zahlreichen Publikationen und Forschungsprojekte der letzten Jahre geben eine ungefähre Vorstellung von der Forschungsrelevanz des thematischen Großkomplexes der Informationsstruktur, der zentrale Fragen des Funktionierens von Sprache umfasst, die teils noch nicht hinreichend verstanden sind.8
Dabei sind die theoretischen Zugänge und Methoden, die zu dessen Erforschung herangezogen werden, sehr heterogen. Auch die rezentesten Monographien, die sich mit der Informationsstruktur romanischer Sprachen auseinandersetzen, spiegeln die Diversität der Ansätze wider. Der pragmatisch basierte Beitrag von Ewert-Kling (2010) etwa untersucht die funktionalen Aspekte von Links- und Rechtsdislokationen im gesprochenen Französischen und Spanischen anhand von Korpusanalysen. Als analoge Untersuchung für das Italienische kann die Arbeit von Meier (2008) genannt werden. Einen vor allem diskursorientierten Ansatz wählt Hidalgo-Downing (2003) für das Spanische. Auch Avanzi (2012) gründet seine Analysen zum Französischen auf Korpora gesprochener Sprache. Er widmet sich in erster Linie der Prosodie ausgewählter Strukturen wie Links- und Rechtsdislokationen. Die Tatsache, dass in den letzten Jahren vermehrt auch generative Beiträge im Bereich der Informationsstruktur zu verzeichnen sind, wie etwa die Arbeiten von Frascarelli (2000) und Bocci (2013) zum Italienischen sowie von Gabriel (2007) zum Spanischen, zeugt von der zunehmenden Bedeutung, die dieser sprachlichen Dimension mittlerweile auch in stärker auf formalen Theorien basierenden Ansätzen beigemessen wird.9
Zweifellos bedarf die gleichzeitige Beschäftigung mit verschiedenen sprachlichen Ebenen wie der Informationsstruktur, der Syntax und der Prosodie einer Kombination unterschiedlicher Methoden. Es ist ersichtlich, dass für den Zweck dieser Arbeit, deren Untersuchungsgegenstand die gesprochene Sprache ist, primär jene Zugänge geeignet sind, die die Akzeptabilität bzw. Angemessenheit von (markierten) Strukturen aus dem Zusammenspiel von grammatisch-syntaktischen und nicht syntaktischen, d.h. prosodischen, aber auch diskursspezifischen sowie außersprachlichen Faktoren zu erklären versuchen, und die damit auch den kommunikativen Kontext von Äußerungen in ihrer Analyse berücksichtigen.10 Einen derartigen Zugang bieten vor allem funktional-pragmatische Ansätze.
Die vorliegende Untersuchung zielt darauf ab, einen klärenden wie auch neue Aspekte erschließenden Beitrag zum Gesamtbild dieser komplexen Thematik zu leisten. Aus funktionaler Perspektive ist die initiale Realisierung von Fokus- und Topikkonstituenten zunächst auf die informationsstrukturellen „Bedürfnisse“ der Gesprächsteilnehmer zurückzuführen. Die im Vergleich zur als unmarkiert geltenden Struktur häufig zu beobachtende Alternation der linearen Abfolge der Konstituenten im Satz und die prosodischen Charakteristika, die mit dieser modifizierten Wortfolge einhergehen, sind demnach – wie die vorliegende Arbeit darzulegen versuchen wird – in erster Linie diskursanalytisch zu erklären und als Manifestationen bzw. als Markierungsmechanismen der Informationsstruktur zu analysieren.
Die Arbeit gliedert sich wie folgt: Kapitel 2 befasst sich mit den Grundlagen und wichtigsten Modellen der Informationsstruktur. Diesem Abschnitt muss insofern relativ viel Raum gewidmet werden, als die Beschäftigung mit Informationsstruktur seit jeher von einer höchst heterogenen Terminologie geprägt ist. Auch in der aktuellen Literatur manifestiert sich die grundlegende Problematik des Gegenstandbereichs darin, dass elementare informationsstrukturelle Termini mit zum Teil sehr unterschiedlichen Bedeutungen verwendet werden. Ziel des Kapitels ist demnach eine klare Abgrenzung der einzelnen Dimensionen innerhalb der Informationsstruktur sowie die Festlegung einheitlicher und möglichst operabler Definitionen zentraler Termini.
Das anschließende Kapitel 3 soll einen kurzen, theoretisch unvoreingenommenen Überblick über die grundlegenden, teils universalen Aspekte des Zusammenspiels von Informationsstruktur, Syntax und Prosodie geben, ohne bereits systematisch sprachenspezifische Aspekte zu berücksichtigen. Es erhebt dementsprechend keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr sollen die verschiedenen Grundannahmen, die in der Literatur vorherrschen, und ihre zentralen Argumente skizziert werden. Näher eingegangen wird in diesem Kapitel darüber hinaus auf die wichtigsten theoretischen Grundlagen der autosegmentalen Phonologie, die aufgrund der guten übereinzelsprachlichen Komparabilität auch für den empirischen Teil der Arbeit von Relevanz sein werden.
Ab Kapitel 4 wird sprachenspezifisch und sprachvergleichend vorgegangen. Kapitel 4.1 klärt zunächst die Frage der Markiertheit von Sätzen im code parlé der drei romanischen Sprachen. Nach einem Überblick über die unmarkierten Muster auf syntaktischer, informationsstruktureller sowie prosodischer Ebene werden in Kapitel 4.2 und Kapitel 4.3 die bisherigen Erkenntnisse zum Topik- bzw. Fokus-Fronting in den jeweiligen Sprachen resümiert.
Kapitel 5 beinhaltet den empirischen Teil der Arbeit. Nach einer kurzen Vorstellung des gewählten Korpus werden Belege mit initialen Topiks und Foki auf unterschiedlichen Ebenen analysiert. Berücksichtigt werden die Art und die Definitheit der Konstituenten, ihre syntaktischen Funktionen, die Belebtheit der Referenten und mögliche kontrastive Lesarten zu entsprechenden Topik- bzw. Fokus-Alternativen. Ebenfalls untersucht wird der syntaktische und prosodische Integrationsgrad der Topiks und Foki. Neben einzelsprachlichen Analysen wird auch ein kontrastiver Vergleich zwischen den drei Sprachen angestrebt, der typologische Ähnlichkeiten und Differenzen aufzeigen soll.
In Kapitel 6 werden die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst und ein Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen gegeben.
2 Grundlagen der Informationsstruktur
2.1 Geschichtlicher Überblick und erste Termini
Der Terminus Informationsstruktur , der heute jenen Teilbereich der Linguistik bezeichnet, der die Art und Weise der Vermittlung von Information auf Satz- und Diskursebene untersucht, geht auf den Beitrag von Halliday (1967a/b) zurück. (cf. Konerding 2003, 209) Halliday (1967a, 55) verwendet den Begriff erstmals, um die Akzeptabilität von Strukturen zu erklären: „[T]he acceptability of a given item is not in fact determined solely by the verb, […] it is often possible to construct acceptable clauses by selecting appropriate lexical items and arranging them in appropriate information structures […].“1
Das Bewusstsein über informationsstrukturelle Aspekte von Sprache reicht bis zur aristotelischen Logik und der dort erfolgten Differenzierung eines Satzes in hypokeimon (‚das Zugrundeliegende‘, ‚Vorhandene‘) und kategorumenon (‚das Ausgesagte‘) zurück, die sich in der Folge zur Dichotomie subjectum-praedicatum entwickelte. (cf. Molnár 1991, 13) Zu einer expliziten und systematischeren Auseinandersetzung mit Informationsstruktur kommt es jedoch erst Mitte des 19. Jahrhunderts durch den Beitrag des deutsch-französischen Philologen Henri (geb. Heinrich) Weil, der Wortstellungsvariationen von Sprachen – am Beispiel des Lateinischen – durch die „succession des idées“ (Weil 1844, 5) erklärt. Weil zufolge muss die Abfolge der Wörter im Satz grundsätzlich mit der Reihenfolge der Gedanken des Sprechers übereinstimmen. Mit anderen Worten ausgedrückt, ist für ihn die Wortstellung von der Informationsstruktur abhängig und ihr damit in gewissem Maße untergeordnet: „[L]’ordre des mots doit correspondre à l’ordre des idées or, pour lui correspondre, si celui-ci change et se renverse, il doit aussi changer et se renverser.“ (Weil 1844, 52) Gleichzeitig weist Weil darauf hin, dass sich Informationsstruktur und Grammatik durchaus auch gegenseitig beeinflussen: „Toutefois dans beaucoup de langues, sinon dans la plupart, la syntaxe et l’ordre des parties de la proposition marchent de front, se déterminent mutuellement.“2 (Weil 1844, 53) Die Zweiteilung des Satzes, auf die Weil in der Folge hinweist, nimmt bereits die zum Teil heute noch gängigen Definitionen der Begriffe Topik und Kommentar 3 vorweg:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Initiale Topiks und Foki im gesprochenen Französisch, Spanisch und Italienisch»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Initiale Topiks und Foki im gesprochenen Französisch, Spanisch und Italienisch» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Initiale Topiks und Foki im gesprochenen Französisch, Spanisch und Italienisch» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.