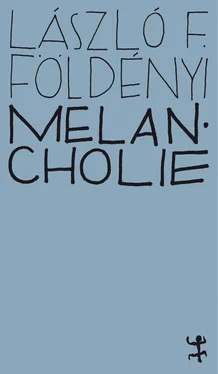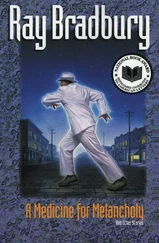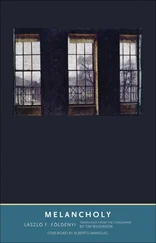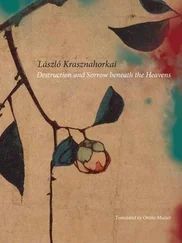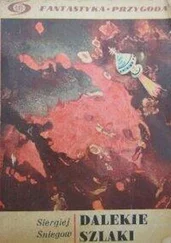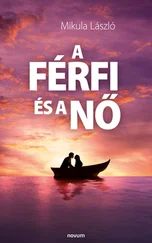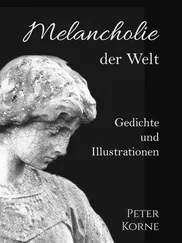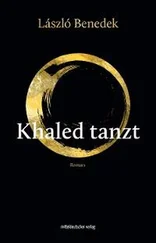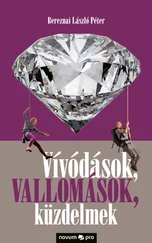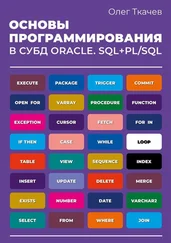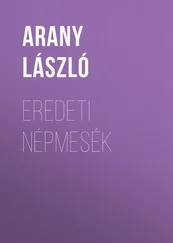László F. Földenyi - Melancholie
Здесь есть возможность читать онлайн «László F. Földenyi - Melancholie» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Melancholie
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Melancholie: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Melancholie»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
"Das Leben heute ist ja so geplant, dass man eigentlich nicht Melancholiker sein darf. Als ich dieses Buch geschrieben habe, versuchte ich eine Art unterirdischer Geschichte von Europa aufzudecken, und ich glaube, dass der Melancholiker dadurch ausgezeichnet ist, dass er sich vor dieser Welt verstecken möchte, er will aber nicht ins Jenseits flüchten, vielmehr ist er vertraut mit einer Geschichte, die verschwiegen und verdrängt wird."
Melancholie — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Melancholie», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Der Melancholiker steht im Grenzbereich von Sein und Nichtsein – solcherart haben wir bisher den Wahnsinnigen und den Wahrsager charakterisiert, und so können wir auch die melancholischen Heroen bestimmen. Der Fall des Bellerophontes zeigt aber, dass diese Grenzsituation den Melancholiker mit Wissen, Einsicht und Weisheit ausrüstet. Vergleichen wir dies mit dem, was wir über den Wahrsager und über den von den Göttern abstammenden Wahnsinn gesagt haben, dann dürfen wir dieses Wissen als ein tieferes betrachten und darin auch den Ursprung der Philosophie sehen. In einem in seinen Jugendjahren verfassten und uns fragmentarisch erhalten gebliebenen Dialog über die Philosophie verfolgt Aristoteles die Liebe zur Weisheit historisch bis zur urhellenischen Theologie, zu den orphischen Lehren und bis zu den persischen Magiern zurück und hält den Vorgang der Verinnerlichung der Philosophie für verwandt mit dem des Eingeweihtwerdens in die Mysterien (denken wir nur an Herakles, der infolge der Einweihung wahnsinnig, melancholisch – und tief blickend wurde), und ähnlich wie Platon bezeichnet er die in die Mysterien Eingeweihten als Philosophen. Wir haben gesehen, dass Platon der Verklärung der Wahrsager durch den Gebrauch des Verbes »wahrsagen« in der Passivform Ausdruck verleiht, und auch der junge Aristoteles betrachtet die Passivität als den für die Einzuweihenden bezeichnenden Zustand (das heißt derjenigen, die der Weisheit zugänglich sind und zur philosophischen Sicht vorbereitet werden sollen). »Jene, die eingeweiht werden, sollen die Dinge nicht aufgrund ihres Sinnes zu erfassen suchen ( μαϑεῖν ), sondern sich eine Art inneren Zustand zu eigen machen ( μαϑεῖν )«. 39Das Pathos bedeutet gleichsam Leidenschaft, Schicksal, Leiden und Erleben – das heißt, im Gegensatz zu der Mathesis, zum Erkennen, meint es keine objektive, rationale Erfassung der Dinge (wobei der Ausdruck »rational« kaum dazu angetan ist, diesen Hergang zu charakterisieren), sondern die innerliche Vereinigung mit denselben, ihr Erleiden im weiteren Sinn des Wortes. Das Pathos, bzw. seine Ausübung, führt zu jener Erleuchtung, die bei Platon der Schlüssel zum Erblicken der Ideen, bei Aristoteles der zum tieferen Verständnis des Seins geworden ist ( ἔλλαμψις) . Der echte Philosoph ist daher auch ein Wahrsager, da ihn aber dadurch, dass er auch Wahrsager ist, gewisse Stränge an den Wahnsinn binden, ist er gleichzeitig ein Melancholiker. Auch er steht im Grenzbereich zwischen Sein und Nichtsein und ist, wie der Wahrsager Heraklit, gezwungen, immer wieder an seinen Ausgangspunkt zurückzukehren: zur Negativität nämlich; die aber nicht das Gegenteil eines als positiv empfundenen Seinszustands darstellt, sondern das Sein selbst, die vollkommene, einzige Wirklichkeit ist. Ich weiß, dass ich nichts weiß – dieser Ausdruck des melancholischen Sokrates (denn auch ihn hielt Aristoteles für einen Melancholiker) ist nicht etwa eine Wortspielerei, sondern vielmehr ein Ausdruck der Ironie, der auf Bestürzung und Betroffenheit folgt. Und als er auf die Frage, ob es sich lohne, in den Ehestand zu treten, den Aufzeichnungen des Diogenes Laertios zufolge, 40antwortete: Egal was du auch tust, du wirst es bereuen, legte er wiederum von der tieferen Berufung des Philosophen Zeugnis ab: den Lernbegierigen an die Grenzen von Sein und Nichtsein zu verbannen, nicht, um ihn der Verzweiflung preiszugeben, sondern damit er mit sich selbst ins Reine komme. (Die teuflische Schlussfolgerung, dass wir gerade dann der Verzweiflung anheimfallen, wenn wir mit uns selbst ins Reine gekommen sind, ist schon das Werk der barocken Seinsauffassung bzw. des treuesten Sokrates-Schülers Kierkegaards.) »Was verdiene ich zu erleiden oder zu erlegen, weshalb auch immer ich in meinem Leben nie Ruhe gehalten, sondern unbekümmert um das, was den meisten wichtig ist, um das Reichwerden und den Hausstand, um Kriegswesen und Volksrednerei und sonst um Ämter, um Verschwörungen und Parteien, die sich in der Stadt hervorgetan, weil ich mich in der Tat für zu gut hielt, um mich durch Teilnahme an solchen Dingen zu erhalten, mich mit nichts eingelassen«. 41(Aufzeichnungen über den anderen melancholischen Philosophen, Empedokles, zeigen ebenfalls, dass er die Freiheit liebte, jede Art der Macht verachtete und das ihm angebotene Amt des Königs zurückgewiesen hat.)
Der melancholische Sokrates, der besessene Erforscher der Wahrheit – sein Wahnsinn, seine Liebe zur Weisheit (Philosophie) und die daraus folgende schwere Melancholie erlauben es ihm, verborgendste Geheimnisse zu schauen. Der Vorwurf, den die Athener gegen ihn vorgebracht haben und der bei Sokrates folgendermaßen Niederschlag fand: »mich […] beschuldigt haben ohne Grund, als gebe es einen Sokrates, einen weisen Mann, der den Dingen am Himmel nachgrübele und auch das Unterirdische alles erforscht habe«, 42war im tieferen Sinne richtig: Hat Sokrates selbst nicht mehrmals betont, dass sein Geist ( δαίμων ) ihm immer das Kommende verkünde? Doch der Dämon, der sich erst viel später als böser Geist entpuppte, ist nicht nur für das Zukünftige verantwortlich, sondern auch Ursprung der Besessenheit – und Ursache seiner Melancholie ist vielleicht gerade diese nie endgültig geklärte Beziehung zur außerirdischen Welt. Dies führte bei Bellerophontes zum Wahnsinn, dieses unnahbare Schicksal verstörte Aias, und die Heimatlosigkeit des zwischen dem göttlichen und dem irdischen Sein Stehenden führte Herakles zuerst in den Wahnsinn, später dann auf den von ihm selbst errichteten Scheiterhaufen. Und dasselbe beunruhigte den sizilianischen Empedokles, dessen Name ebenfalls unter den von Aristoteles aufgezählten melancholischen Philosophen zu finden ist: »Denn sie [die Gottheit, L. F.] ist auch nicht mit menschenähnlichem Haupte an den Gliedern versehen, nicht schwingen sich fürwahr vom Rücken zwei Zweige, nicht Füße, nicht schnelle Knie, nicht behaarte Schamglieder, sondern ein Geist, ein heiliger und übermenschlicher regt sich da allein«. 43Dies war es, was den Geist des Bellerophontes vernebelte, und auf seine Art ist auch Empedokles als Besessener zu betrachten, der zwar nicht an den Göttern zweifelte, ihr Sein aber so weit auflöste, dass er gezwungen war, den Pfad in Richtung Mystik einzuschlagen. Er selbst rief sich zum Gotte aus, der als Sühne seiner im früheren Leben begangenen Sünden lange Zeit außerhalb der Welt der Götter, auf dem mühseligen Pfad des Lebens wandelnd, verweilen musste: »[M]ehr bin [ich] als die sterblichen, vielfachem Verderben geweihten Menschen«: 44unsterblicher Gott ( Θεός ἄμβροτος ), der sich über alle Rätsel des irdischen Lebens im Klaren und diese aufgrund seines Wissens von außen zu betrachten in der Lage ist: »Denn engbezirkt sind die Sinnes Werkzeuge, die über die Glieder gebreitet sind; auch dringt viel Armseliges auf sie ein, das stumpf macht die Gedanken. Und schauten sie in ihrem Leben vom (All)leben nur kleinen Teil, so fliegen sie raschen Todesgeschicks wie Rauch in die Höhe getragen davon, von dem allein überzeugt, worauf jeder einzelne gerade stieß bei seinen mannigfachen Irrfahrten, und doch rühmt sich jeder das Ganze gefunden zu haben. So wenig ist dies für die Menschen erschaubar oder erhörbar oder mit dem Geiste umfaßbar«. 45Das Leben des Menschen ist ewiges Leiden: »O ewiges Geheimnis! was wir sind und suchen, können wir nicht finden; was wir finden, sind wir nicht«. 46
Das sind schon Hölderlins Worte in seinem über Empedokles verfassten Drama, und wie die Heroen irrt auch Empedokles am Grenzrain jenseits des Menschseins, aber diesseits des Gottseins umher. Sein Wissen berechtigt ihn, über alles ein Urteil zu fällen, doch ist es gerade dieses Wissen, das ihn aus dem Rahmen des irdischen Seins verbannt hat: Wer alles durchschaut, dessen Heimat ist die Unendlichkeit oder, besser gesagt, die Heimatlosigkeit. Ob Empedokles, diese historische Figur, wirklich alles gewusst hat, bleibt als offene Frage stehen (seine Zeitgenossen meinten »ja«, und auch Lukrez schrieb später über ihn: »Ut vix humana videatur stirpe creatus« 47– als ob sein Vater kein Sterblicher gewesen wäre); wichtiger aber ist, dass er selbst in dieser Überzeugung gelebt hat. Diese Überzeugung aber reichte aus, dass ihm das gleiche Schicksal zuteilwurde wie den Heroen: Seine übermenschliche, außerordentliche Leistung (er war der ausgezeichnetste Arzt seiner Zeit), sowie die Zerklüftung seiner Seelenbereiche (er war Philosoph, das heißt Wahrsager, demzufolge Wahnsinniger bzw. Ekstatiker) sind voneinander nicht zu trennen. »So ward auch mir das Leben zum Gedicht«, 48legt ihm wiederum Hölderlin in den Mund, nicht ohne eine gewisse romantische Voreingenommenheit einer scheinbaren Abrundung gegenüber (denn was von außen gesehen als Dichtung erscheint, erscheint von innen her als eine Anhäufung prosaischer Zerrissenheit). Es gibt aber keine Abrundung: Auf dem Empedokles darstellenden Gemälde von Luca Signorelli im Dom von Orvieto scheint der die Sterne beobachtende Philosoph aus dem Bilde herauszufallen, womit die geschlossenen Regeln der Renaissance-Perspektive ziemlich zerstört werden. Das ist der Fall des Empedokles (natürlich auch bei Hölderlin), und er war es, dem sich Hölderlin verwandt fühlte, auch Novalis, und über den – und zwar in alle Maße entbehrender Prosa – Nietzsche eine Tragödie verfassen wollte. Seine Melancholie ist eine vielfach zusammengesetzte: Der Glaube an seine eigene Göttlichkeit machte ihn im platonischen Sinne zum Besessenen; die Erforschung der Vergänglichkeit führte ihn über die Grenzen des Seins hinweg: Seinem Schüler Pausanias vermittelte er, wie der Scheintote ins Leben zurückzuholen sei, und den Erzählungen des Herakleides Pontikos zufolge hat er viele Menschen aus dem Reiche Persephones zurückgebracht; an die Grenzen von Sein und Nichtsein gelangend, erhielt er Einblick in die Rätsel des Seins. Deshalb ist auch sein Tod kein alltäglicher: Wer das Leben und den Tod zu relativieren vermag, für den ist auch der Tod kein Tod als solcher, sondern eine Vervollkommnung. Nicht im christlichen Sinne, sondern dem griechischen Gedankengut entsprechend: Im Verhältnis zur Ausschließlichkeit des Seins werden Leben und Tod zweitrangig. Das Sein beansprucht uns auch jenseits des Todes; die Erkenntnis dieses Tatbestandes ist für den Menschen zugleich erhebend und niederschmetternd. Notwendigerweise sind uns auch über den Tod des Philosophen zwei Berichte überliefert worden. Dem einen zufolge haben ihn seine Genossen am Morgen nach dem Opferfest nicht mehr aufgefunden. Ein Diener berichtete ihnen, dass er gegen Mitternacht von der Stimme des Empedokles aufgeweckt worden sei und, sich von seinem Lager erhebend, ein loderndes, fackelartiges himmlisches Licht erblickt habe. Pausanias, der Schüler von Empedokles, habe dann das Rätsel entwirrt; die Götter hätten Empedokles zu sich gerufen, und er habe die Welt nicht als Mensch, sondern als Gott hinter sich gelassen. Dem zweiten Bericht zufolge haben die Götter Empedokles nicht zu sich gerufen: Er selbst habe seinem Leben ein Ende bereitet und sich, um seine Göttlichkeit zu beweisen, in den Krater des Ätna hinabgestürzt. Doch auch dieser Sprung hat seinen tieferen Sinn: Einerseits betrachteten die Griechen den Sprung in die Tiefe als eine Form der Ekstase und somit als einen schönen Tod ( εὺJάνατος ) (denken wir hier an die göttliche Verbindung von Melancholie und Ekstase), andererseits aber brachte das Verbrennen im Feuer Reinigung. Von der irdischen Schlacke wird der Sterbliche im Feuertod gereinigt ( καJάρσιον πῦρ ), und deshalb ist das Feuer auch die Bedingung zum Eintritt in ein Leben höherer Ordnung. 13 Dem griechischen Denken gemäß sicherte der Feuertod des Herakles, der eine unvermeidliche Konsequenz seiner Melancholie war, ihm ebenso die Unsterblichkeit wie dem Philosophen Empedokles. 14 So wird das Feuer zur Quelle eines Lebens höherer Ordnung: es ist Geist, Logos (Heraklit). 15 Der selbst gewählte Feuertod des Philosophen Empedokles vollzog sich im Banne des »Auferstehens« und führte ihn aus jener irdischen Welt heraus, die für Platon Gefängnis, für Empedokles aber Hölle war. (So Schiller über den vergeistigten Herakles, der den Feuertod erlitt: »Er ist des Irdischen entkleidet.«) Dem Tode folgte aber nicht unbedingt ein Auferstehen; wie der echte Wahrsager außerhalb der Zeit stehend auf die Beschaffenheit der menschlichen Zeit herabblickt, so ist auch die Auferstehung kein sich innerhalb der Zeit vollziehender Akt. Er überschreitet das Leben ebenso wie den Tod. Wie aber der Tod nicht für jeden die Auferstehung bedeutet, so haben auch nur wenige schon im Leben an der Auferstehung teil. Die Auferstehung ist, wie schon der Begriff andeutet, eine seelisch-körperliche Erscheinung; ihre griechische Entsprechung ( ἔγερσις ) bedeutet auch Erwachen, was so viel wie Heraustreten aus einem vorangehenden Zustand ist. Und da dieses Heraustreten ( ἔκστασις) an einen Augenblick geknüpft ist, hat es (nicht nur grammatisch gesehen) absolut gegenwärtigen Charakter. Aus unserem bisherigen Gedankengang folgt, dass die Auferstehung jenen zuteilwird, die nicht nur die Gesetze des Innerzeitlichen, sondern auch die über die Zeit hinausgehenden erkennen und die deren Möglichkeiten und Grenzen erblicken. Das sind: die Wahrsager, die Wahnsinnigen, die außerordentlichen Menschen, die Philosophen – mit einem Wort, jene, die wir Melancholiker nennen dürfen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Melancholie»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Melancholie» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Melancholie» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.