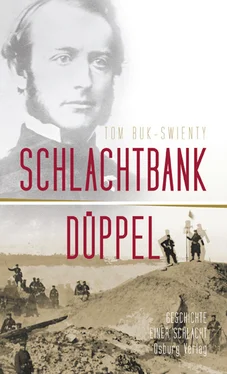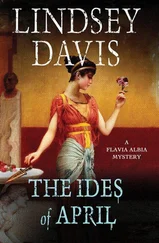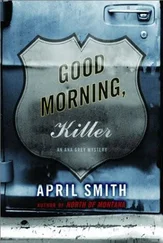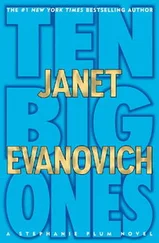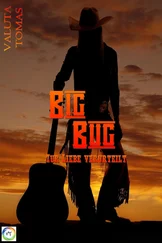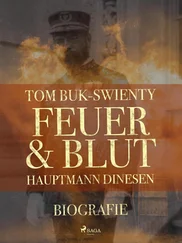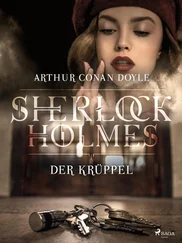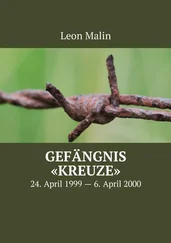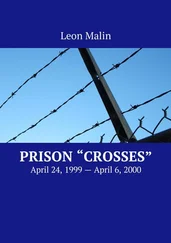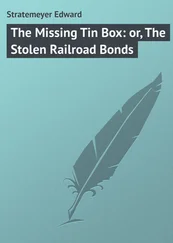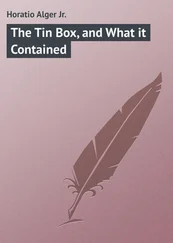Damit war das Rote Kreuz ins Leben gerufen. Nun ging es darum, die gesamte internationale Gemeinschaft zu überzeugen, man musste die Information über die Organisation verbreiten. Gleichzeitig galt es, die gegenwärtigen Schlachtfelder und die Verhältnisse für die Verwundeten zu studieren.
Van de Velde reiste nach Dänemark, um das Land für die Idee einer internationalen Hilfsorganisation zu gewinnen und sich das Kampfgebiet anzusehen. Außerdem wollte er sich persönlich um Verwundete kümmern, wenn die Möglichkeit sich ergab.
Wenn van de Velde angesichts seiner Erlebnisse in Dänemark häufig deprimiert war, so lag das nicht allein an den Grausamkeiten auf dem Schlachtfeld, sondern auch daran, dass die Dänen ihm sehr lange die kalte Schulter zeigten. Sie betrachten diesen Mann, der vier Sprachen sprach –, Französisch, Deutsch, Englisch und Holländisch, aber nicht Dänisch – mit Misstrauen. »Wozu braucht es eine internationale Organisation?« Die Dänen als Menschenschlag, konstatierte van de Velde in seinen Briefen, seien »verschlossen«, »insulär« und »selbstzufrieden«. Kurz gesagt, sie waren, wie er mehrfach betonte, »veritable Inselbewohner«. In einem Brief an Dunant vom 11. April schrieb van de Velde, »die Dänen halten an ihren eigenen Ideen fest und fürchten sich vor allen Vorschlägen, die von außen kommen. Sie haben eine deutliche Angst vor dem Fremden … Bei diesem Widerstand gegen neue Gedanken ist meine Aufgabe nicht leicht.«
Zumal die Dänen laut van de Velde in einem gottverlassenen Teil der Welt wohnten. Er war am 2. April von Paris mit dem Zug über Köln und Hamburg nach Lübeck gereist und von dort mit dem Dampfschiff nach Malmö gefahren. Kopenhagen erreichte er am 9. April. Die Reise »erschöpfte mich durch große Kälte und zehrte an meinen Kräften«.
Um zu illustrieren, wie schlimm die Kälte im Norden war, schrieb er, im Abteil der Waggons, in dem er von Köln nach Lübeck gesessen hatte, wären »die Fenster von einer dicken Eisschicht bedeckt gewesen, trotz der Wärme, die von sechs Deutschen im Abteil ausging«.
An Bord des Dampfschiffs nach Malmö war es noch kälter. »Die Überfahrt über das Baltische Meer dauerte achtzehn Stunden, gleichzeitig blies ein heftiger Nordwind, der das gesamte Tauwerk vereiste … Das Klima in diesen Breitengraden ist fürchterlich. Erst heute hat der Wind nachgelassen, aber er wurde ersetzt durch einen feuchten Nebel, so wie er in Genf im Februar vorkommen kann.«
Die Stimmung in Kopenhagen war düster. Die letzten Bulletins zeigten, dass es im dänischen Heer 5136 verletzte und kranke Soldaten gab, die in 26 Krankenhäusern im ganzen Land lagen. Gut die Hälfte der Verwundeten allerdings in Kopenhagen, »wo es kein Gebäude mehr gibt, das noch sehr viel mehr aufnehmen könnte«.
Van de Velde erlebte eine vom Krieg gezeichnete Hauptstadt:
»Brüder, Väter, Freunde … versammeln sich an den Straßenecken, um über die Beschießung von Düppel zu lesen, ständig werden Neuigkeiten angeschlagen. Ich fühle mit ihnen und sympathisiere mit all diesen trauernden Menschen, die ich überall treffe, und ich höre ihren Erzählungen über ihre Liebsten aufmerksam zu, die Tag und Nacht dem Kugelhagel ausgesetzt sind. Die Menschen, denen ich begegne, versuchen, ihre Liebe zum Vaterland mit ihrer Liebe zu ihren nächsten Angehörigen draußen an der Front in Einklang zu bringen, um deren Leben sie fürchten.«
In Kopenhagen traf van de Velde mit internationalen Zeitungskorrespondenten zusammen, die aus Düppel geflohen waren, weil sie »es für unmöglich hielten, mehr Zeit beim Heer zu verbringen. Sønderborg existiert nicht mehr. Die gesamte Stadt ist zerstört. In Augustenborg hat der Typhus die Armee und die Bewohner dezimiert. Lebensmittel und Unterkunft kosten wahnsinnige Preise …«
Van de Velde verbrachte eine Reihe von Tagen in Kopenhagen mit dem Versuch, die Dänen für die Idee des Roten Kreuzes zu gewinnen. Gewisse Sympathien erlangte er bei Ministerpräsident Monrad wie bei Kriegsminister Lundbye und der Königinwitwe Gräfin Danner. Doch vor allem waren die Dänen in einem Maße skeptisch, dass van de Velde, dem es normalerweise schwerfiel, sich herabsetzend über jemanden zu äußern, sich genötigt sah, festzustellen, der dänische Nationalcharakter sei »langsam«, »kalt« und nicht in der Lage, »Enthusiasmus zu zeigen«.
Vor allen sein Treffen mit dem dänischen Chefarzt Michael Djørup war niederschmetternd. Van de Velde nannte ihn hinterher »starrköpfig« und »ehrsüchtig«, weil Djørup die Idee rundweg ablehnte, Frauen könnten im Feld als Pflegerinnen fungieren – eine Idee, für die Dunant aufgrund seiner Erfahrungen bei Solferino eintrat. Krankenpflege in Kriegsgebieten sei eine Männerdomäne, für die Frauen weder die Fähigkeiten noch die Nerven hätten, meinte Djørup. Schockiert stellte van de Velde fest, dass die dänische Ärzteschaft sogar schwedische Frauen wieder nach Hause geschickt hatte, die nach Kopenhagen gekommen waren, um sich freiwillig als Pflegerinnen zu melden.
Obwohl van de Velde seinen Aufenthalt in Kopenhagen mit sehr gemischten Gefühlen betrachtete, konnte er sich doch nicht recht entschließen, nach Düppel zu reisen. Er wirkte ängstlich und schien den Termin der Abreise immer wieder hinauszuschieben. Er schrieb, er hoffe, Gott würde ihm das Leben schenken, denn seiner Ansicht nach würde der Aufenthalt bei der Armee »mit sicheren Gefahren verbunden sein … [in Sønderborg und Düppel] sind überall Bomben«.
Am 16. April traf er schließlich an der Front ein.
In seinem Brief vom 17. April beschrieb van de Velde, dass der Widerstand gegen eine internationale Hilfsorganisation, der ihm in Kopenhagen entgegenschlug, nichts war im Vergleich mit der Reaktion des dänischen Chefarztes bei Düppel, John Rørbye. Rørbye hatte ihm erklärt, es gebe keinerlei Bedarf für eine internationale Organisation. Es sei mehr als genug, wenn jedes Land seine eigenen privaten Wohltätigkeitsinstitutionen hätte.
Rørbye erzählte van de Velde, im dänischen Heer gebe es keinen Mangel an Männern, die »bei der Krankenversorgung helfen. Und wenn man etwas ganz bestimmt nicht wünschte, dann wären es ausländische Ärzte. Wegen ihrer mangelnden Dänischkenntnisse würde es nur zu Verzögerungen kommen.«
»Ich bot an«, schrieb van de Velde an Dunant, »dafür zu sorgen, Ärzte aus Holland nach Düppel zu senden, aber auch das wollte er nicht. Dann bot ich Hilfe aus Genf an. Er lehnte rundweg ab. Ich unterbreitete ihm die Ideen, wie man bessere Tragen für die Verwundeten bauen könnte. ›Nein, nein‹, antwortete Rørbye, ›es ist jetzt nicht die Zeit, um sich mit solchen Neuerungen zu befassen.‹ … Unglaublich, dass solch ein alter ruhmsüchtiger Mann an die Spitze einer so großen Unternehmung gestellt wird.«
Weitaus mehr Glück, sich für die Ideen des Roten Kreuzes Gehör zu verschaffen, hatte der zweite Abgesandte, Louis Appia. Die preußische Führung stand der Idee einer neutralen, internationalen Organisation positiv gegenüber (König Wilhelm I. war begeistert, als Dunant ihn 1863 in Berlin besuchte). Appia konnte vor den Generälen bei Düppel sprechen, er wurde von Marschall Wrangel zum Abendessen eingeladen und er bekam die Erlaubnis, sich an der Front frei zu bewegen. Dass seine Anwesenheit so positiv aufgenommen wurde, lag unter anderem an den Fortschritten auf medizinischem Gebiet. Hier waren die Preußen sehr viel weiter als ihre dänischen Gegner. Die preußische Armee hatte einige der fachlich besten Ärzte der Zeit in ihrem Stab, darunter Friedrich von Esmarch, den Vater der modernen Kriegschirurgie, auf den zahlreiche Erfindungen zurückgehen: bessere Blutstillmechanismen, Chloroformmasken, Prothesen und gefederte leichte Wagen für die Verwundeten. Gleichzeitig wurden im Gegensatz zum dänischen Heer auf deutscher Seite weit mehr freiwillige Hilfsorganisationen an der Front zugelassen, unter anderem der Johanniterorden und Diakonissen von einigen religiösen Organisationen in Deutschland.
Читать дальше