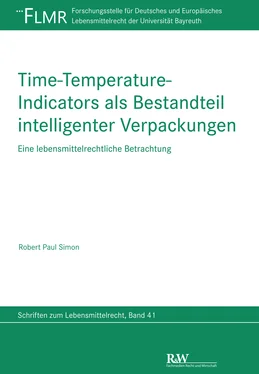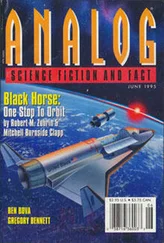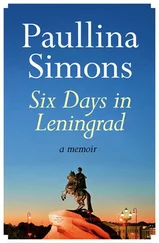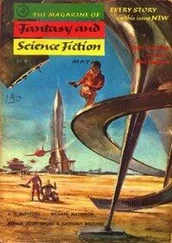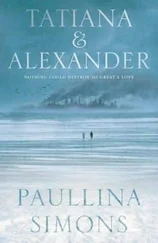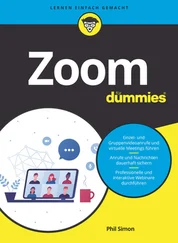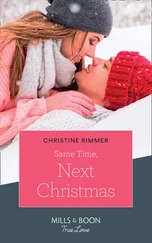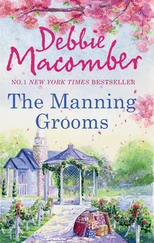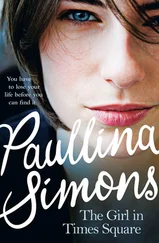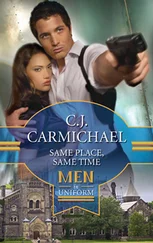1 Intelligente Verpackungen sind solche, deren Materialien und Gegenstände den Zustand von verpackten Lebensmitteln oder die das Lebensmittel umgebende Umwelt überwachen.1 Ihre Funktionalitäten umfassen daher zum einen die Überwachung der unmittelbaren Qualitätsmerkmale des Lebensmittels, etwa dessen Frische, von sensorischen Eigenschaften wie Geruch und Aussehen und von mikrobiologischen Kriterien wie das Vorhandensein von pathogenen Mikroorganismen, Bakterien, Toxinen und weiterem mehr. Zum anderen dienen intelligente Verpackungen der Dokumentation der Umgebungsbedingungen, etwa der Temperatur, der verstrichenen Zeit, entwichener Gase oder der relativen Luftfeuchtigkeit. Zu diesen funktionellen Zwecken kommen vor allem drei Technologien, auch kombiniert, zum Einsatz: Datenträger, Indikatoren und Sensoren. Auf dem deutschen Lebensmittelmarkt werden bisher praktisch keine intelligenten Verpackungen verwendet. Auch auf europäischer Ebene beschränkt sich ihr Gebrauch auf Einzelfälle. Größere Einsatzgebiete finden sich hingegen in den USA, Japan oder Neuseeland.2 1 So die Definition für „intelligente Lebensmittelkontakt-Materialien und -Gegenstände“ nach Art. 2 Abs. 2 lit. b BedarfsgegenständeVO. 2 Überblick über die unterschiedlichen Erscheinungsformen intelligenter Verpackungen siehe zum Beispiel Müller/Schmid/Lindner, DLG-Expertenwissen 7/2019; Ghaani/Cozzolino/Castelli/Farris, Trends in Food Science & Technology 51 (2016), 1–11; Dainelli/Gontard/Spyropoulos/Zondervan-van den Beuken/Tobback, Trends in Food Science & Technology 19 (2008), 103–112; de Jong/Boumans/Slaghek/van Veen/Rijk/van Zandvoort, Food Additives and Contaminants 22 (2005), 975–979.
So die Definition für „intelligente Lebensmittelkontakt-Materialien und -Gegenstände“ nach Art. 2 Abs. 2 lit. b BedarfsgegenständeVO. 2Überblick über die unterschiedlichen Erscheinungsformen intelligenter Verpackungen siehe zum Beispiel Müller/Schmid/Lindner, DLG-Expertenwissen 7/2019; Ghaani/Cozzolino/Castelli/Farris, Trends in Food Science & Technology 51 (2016), 1–11; Dainelli/Gontard/Spyropoulos/Zondervan-van den Beuken/Tobback, Trends in Food Science & Technology 19 (2008), 103–112; de Jong/Boumans/Slaghek/van Veen/Rijk/van Zandvoort, Food Additives and Contaminants 22 (2005), 975–979.
1. Time-Temperature-Indicators (TTI)
Im Verbundprojekt Intelli-Pack stehen Zeit-Temperatur-Indikatoren (time temperature indicators – TTI)3 im Fokus. Diese sollen im Folgenden beispielhaft anhand des „Fresh Meter“-Etiketts des Projektpartners Bizerba, welches auf dessen „OnVu“-Technologie basiert, erläutert werden.
Das Kernstück von „Fresh Meter“ besteht aus einer speziellen, temperatursensiblen Tinte, welche als „Wärmegedächtnis“ Wärmeeinflüsse sammelt und speichert. Das Etikett wird mittels UV-Strahlung direkt nach dem Verpacken des jeweiligen Lebensmittels, auf welchem es angebracht ist, aktiviert, wodurch es sich dunkelblau färbt. Im Laufe der Zeit entfärbt sich das Etikett zurück zu grau. Dieser Entfärbungsprozess ist die einfache Visualisierung des „Wärmegedächtnisses“, denn bei höherer Temperatur läuft der Prozess umso schneller ab. Bei „Fresh Meter“ handelt es sich daher um einen TTI.
Durch den TTI soll auf leichte und verständliche Weise erkennbar werden, ob das Produkt noch frisch ist. Als Referenz dient ein Kreis, welcher um den temperatursensiblen Kern mit normaler Tinte gedruckt ist und den Farbverlauf von dunkelblau zu grau darstellt, wobei der dunkelblaue Bereich als „frisch“ gilt und die Skala mit einem Bereich „nicht verwenden“ endet.

Abbildung:„Fresh Meter“-Etikett der Firma Bizerba im geladenen Zustand.
Je nach Belichtungszeit mit UV-Licht ist das Etikett für einen bestimmten Zeitraum – etwa bis zu einem Mindesthaltbarkeits- oder Verbrauchsdatum – aktiviert. Das Label ist für einen Zeitraum von höchstens 10–14 Tagen ausgelegt. Grundsätzlich kann das Label durch eine erneute Bestrahlung mit UV-Licht, auch durch einfaches Sonnenlicht, erneut aktiviert, der Wärmespeicher also ganz oder zum Teil gelöscht werden. Dies wird jedoch durch eine Schutzfolie, welche nach der Aktivierung auf das Etikett geklebt wird, verhindert. Die Technologie ist zuverlässig und erbringt reproduzierbare Ergebnisse. Das Label lässt sich durch Variation der Belichtungsdauer auf unterschiedliche Kühlkettenbedingungen einstellen.
Ein weiteres Beispiel für einen TTI ist das System „Keep-it“ der Firma Keep-it Technologies, welches in erster Linie in norwegischen Supermärkten zu finden ist und sich selbst als „genaueres ‚Mindesthaltbarkeitsdatum‘“ bezeichnet.4 Ähnlich wie „Fresh Meter“ ändert sich hier die Länge des Farbbalkens mit Zeit und Temperatur.
Ein anderes Konzept verfolgt der schwedische „Tempix“-Temperatur-Indikator, welcher anhand eines schwarzen Strichs bzw. durch dessen Verschwinden anzeigt, ob eine bestimmte Temperatur überschritten wurde. Dieses Label wird in Schweden und Finnland verwendet.5
3Zu TTI siehe zum Beispiel die genannten Überblicksartikel sowie Kraft/Zajonc/Ducci, PdN 2012, 29–35. 4Zu Keep-it siehe www.keep-it.com, auch in deutscher Sprache. 5Zu Tempix siehe www.tempix.com.
2. Lieferketten im Lebensmittelsektor
TTI lassen sich sinnvoll entlang der unterschiedlichen Lieferketten im Markt für Lebensmittel anwenden. Weitere Anwendungsfelder bestehen für sämtliche kühlpflichtigen Güter wie bestimmte Arzneimittel oder auch Schnittblumen.
Die im Projekt Intelli-Pack beispielhaft behandelten Lieferketten umfassen sowohl den Bereich Business-to-Business (B2B) als auch Business-to-Consumer (B2C). Zu den Produkten gehören verpackte Fisch-, Fleisch- und Gemüseprodukte, sodass die Produkte während der Anwendung des jeweiligen TTI-Etiketts von anderen äußeren Einflüssen als Zeit und Temperatur möglichst abgeschirmt sind. Dennoch können weitere Einflüsse, unter anderem die bereits beim Verpacken vorhandenen Mikroorganismen, mechanische Einwirkungen und unsachgemäße Behandlung, in den Lebensmittellieferketten der Praxis nicht ausgeschlossen werden.
Die Haltbarkeit der Produkte bewegt sich im Bereich weniger Tage, wobei an den verschiedenen Produkten sowohl Mindesthaltbarkeits- (MHD) als auch Verbrauchsdaten (VD) verwendet werden. Die TTI können sowohl an der Produktverpackung selbst als auch in Versand- bzw. Transportkisten sowohl im Bereich B2C als auch B2B angebracht werden.
Die betrachteten Lieferketten reichen „vom Acker auf den Teller“ und beginnen im Produktions-, Schlacht- oder Fischfangbetrieb, umfassen auch mehrfache Lagerung, Kommissionierung und Transporte und führen entweder per Kurierzustellung oder über den SB-Lebensmitteleinzelhandel zum Verbraucher. Dort endet die Kette noch nicht, sondern sie erfasst weiter den Transport in die Wohnung des Verbrauchers, sei es durch den Kurier oder im eigenen Fahrzeug, sowie die heimische Lagerung in Kühlschrank und Gefriertruhe. Im besonderen Interesse steht somit das Verhalten des Verbrauchers, in dessen Händen regelmäßig und geradezu unausweichlich eine Unterbrechung der Kühlkette auftritt.
3. Zielsetzung und Gliederung des Beitrags
Der vorliegende Beitrag beschränkt sich nicht auf die Lieferketten und Produkte, die im Verbundprojekt in anderen Kontexten untersucht werden, sondern versucht, erste Antworten zu rechtlichen Fragestellungen und einen Überblick über regulatorische Gestaltungsmöglichkeiten für den Einsatz speziell von TTI im Lebensmittelsektor zu geben. Dabei fließen immer wieder übergreifende Überlegungen ein, die auch auf andere Formen intelligenter Verpackungssysteme anwendbar sind.
Читать дальше