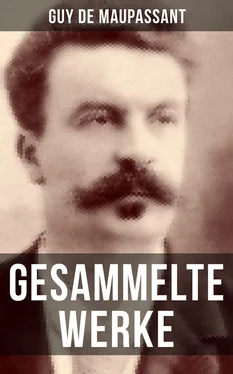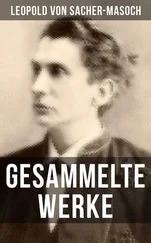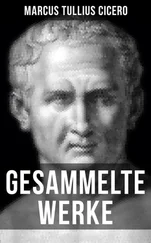Dann sagte er leise:
– Jetzt muß man Bilder kaufen, die Maler haben nichts zu beißen, keinen Pfennig in der Tasche.
Aber Duroy sah nichts und hörte zu ohne zu verstehen. Frau von Marelle war da, hinter ihm. Was sollte er thun? Würde sie ihm nicht, wenn er sie grüßte, den Rücken drehen, oder ihm irgend eine Beleidigung an den Kopf werfen? Und was sollte sie denn denken, wenn er sich ihr gar nicht näherte?
Er sagte sich: – Ich muß Zeit gewinnen. Er war so aufgeregt, daß er daran dachte, ein plötzliches Unwohlsein vorzuschützen, um sich aus dem Staube machen zu können.
Sie hatten jetzt alle Bilder angesehn. Der Chef setzte die Lampe wieder auf den Tisch, um die zuletzt Gekommene zu begrüßen, während Duroy die Gemälde ganz allein noch weiter betrachtete, als ob er gar nicht genug sehen könnte. Der Kopf war ihm wirr, er hörte Stimmen, er unterschied die Unterhaltung. Frau Forestier rief:
– Sagen Sie mal, Herr Duroy … er trat auf sie zu. Sie wollte ihm eine Freundin empfehlen, die ein Fest gab, das sie gern in der › Vie française ‹ besprochen haben wollte.
Er stammelte: – Aber natürlich, gnädige Frau, natürlich.
Jetzt stand Frau von Marelle ganz nahe bei ihm. Er wagte nicht, sich umzuwenden.
Da plötzlich – war er denn verrückt geworden – sagte sie laut: – Guten Tag, Liebling! Kennen Sie mich denn nicht mehr?
Sofort drehte er sich um, sie stand lächelnd vor ihm, und aus ihren Blicken leuchteten Heiterkeit und Liebe. Sie streckte ihm die Hand entgegen.
Zitternd nahm er sie. Er befürchtete noch immer eine Falle. Sie fügte freundlich hinzu: – Wie geht es Ihnen denn? Man sieht Sie ja gar nicht mehr!
Er stammelte, ohne seine Kaltblütigkeit ganz wieder gewinnen zu können: – O, ich habe viel zu thun gehabt, sehr viel zu thun. Herr Walter hat mir ein neues Ressort überwiesen, das macht Riesen-Arbeit.
Sie antwortete und blickte ihn gerade an, ohne daß er in ihren Augen etwas anderes als Wohlwollen lesen konnte. – Ich weiß, aber das ist doch kein Grund, Ihre Freunde ganz zu vergessen.
Sie wurden getrennt durch eine dicke Dame, die eben hereinkam. Eine dicke Dame mit entblößten Schultern, roten Armen, rotem Gesicht, in anspruchsvoller Toilette und Haartracht. Sie trat so schwer auf, daß man Gewicht und Umfang ihrer Beine förmlich fühlte, wenn sie ging.
Da man sie offenbar mit besonderer Auszeichnung behandelte, so fragte Duroy Frau Forestier:
– Wer ist denn das?
– Die Vicomtesse von Percemur, die bei uns »Sammetpfötchen« zeichnet.
Er war ganz erstaunt und hatte Lust zu lachen:
– Sammetpfötchen, Sammetpfötchen, und ich bildete mir ein, das müßte so eine Frau sein wie Sie! Das ist das Sammetpfötchen! Na, das ist gut, die kann so bleiben!
Ein Diener erschien in der Thür und meldete:
– Es ist angerichtet.
Das Diner war banal und heiter. Eines jener Diners, bei dem man von allem spricht und von nichts.
Duroy saß zwischen der ältesten Tochter des Chefs, der häßlichen, Fräulein Rosa Walter, und Frau von Marelle, deren Nachbarschaft ihn ein wenig genierte, obgleich sie sehr vergnügt war und mit ihrem gewohnten Witz plauderte. Er war zuerst verlegen und tastete und zögerte wie ein Musiker, der aus dem Takt gekommen ist. Doch allmählich kehrte seine Sicherheit zurück, und ihre Augen begegneten sich fortwährend, befragten sich und tauchten vertraulich, fast sinnlich ineinander, wie früher.
Plötzlich war ihm, als fühlte er unter dem Tisch etwas seinen Fuß berühren. Er streckte vorsichtig das Bein aus und begegnete dem seiner Nachbarin, das der Begegnung nicht auswich. In diesem Augenblick sprachen sie nicht, und wendeten sich beide zu ihren Nachbarn auf der anderen Seite.
Duroy schob klopfenden Herzens sein Knie noch weiter vor. Ein leiser Druck antwortete ihm. Da begriff er, daß ihre zärtlichen Beziehungen wieder begonnen.
Sie sprachen nicht mehr viel, aber ihre Lippen zitterten jedesmal, wenn sie sich anblickten.
Ab und zu richtete der junge Mann, der gegen die Tochter seines Chefs liebenswürdig sein wollte, das Wort an diese. Sie antwortete genau wie ihre Mutter, die nie einen Augenblick verlegen war, was sie sagen sollte.
Rechts von Herrn Walter saß die Vicomtesse von Percemur, wie eine Fürstin, und Duroy, dem es Spaß machte, sie zu betrachten, fragte ganz leise Frau von Marelle:
– Kennen Sie auch die andere, die »Rosa Domino« zeichnet?
– Natürlich, Baronin von Livar.
– Ist das auch die Sorte?
– Nein, aber ebenso komisch; groß, dürr, sechzig Jahre alt, falsche Löckchen, englische Raffzähne, Geist aus der Zeit der Restauration, Toilette so auch etwa um die Zeit.
– Wo haben sie denn nur diese Litteraturwunder aufgegabelt?
– O, der Abhub des Adels wird von bürgerlichen Parvenüs immer gut aufgenommen!
– Ein anderer Grund ist nicht vorhanden?
– Nein!
Dann begann ein politisches Gespräch zwischen dem Chef, den beiden Abgeordneten, Norbert von Varenne und Jacques Rival. Das dauerte bis zum Nachtisch.
Als sie wieder drüben im Salon standen, näherte sich Duroy von neuem Frau von Marelle und blickte ihr in die Augen.
– Soll ich Sie heute abend nach Hause bringen?
– Nein.
– Warum nicht?
– Weil Herr Laroche-Mathieu,, mein Nachbar, mich jedesmal an meiner Thür absetzt, wenn ich hier esse.
– Wann sehe ich Sie wieder?
– Kommen Sie morgen zum Frühstück zu mir.
Und sie trennten sich, ohne ein Wort mehr zu sprechen.
Duroy blieb nicht lange, er fand die Gesellschaft langweilig.
Als er die Treppe hinunter ging, holte er Norbert von Varenne ein, der sich auch entfernt hatte.
Der alte Dichter nahm seinen Arm. Seit er keine Rivalität bei der Zeitung mehr von ihm zu fürchten brauchte, da ihre Thätigkeit sich gar nicht berührte, hatte er für den jungen Mann eine Art von väterlichem Wohlwollen angenommen.
– Nun Sie begleiten mich doch ein Stück?
Duroy antwortete:
– Aber gewiß, mit Freude!
Und sie schritten langsam den Boulevard Malesherbes hinab.
Paris war beinahe ausgestorben diese Nacht. Es war kalt, eine jener Nächte wo man meinen könnte, alles wäre weiter, größer, wo die Sterne höher stehen, wo die Luft in ihrem eisigen Hauch etwas daher zu tragen scheint, das noch weiter her kommt, als von den Gestirnen. Im ersten Augenblick sprachen die beiden Männer nichts.
Dann meinte Duroy, um etwas zu sagen:
– Dieser Herr Laroche-Mathieu scheint sehr gescheit und unterrichtet zu sein.
Der alte Dichter brummte:
– So, finden Sie?
Der junge Mann hielt erstaunt inne:
– Nun ja, er gilt doch auch für einen der fähigsten Leute in der Kammer.
– Das kann sein. Unter den Blinden ist der Einäugige König. Wissen Sie, alle diese Leute sind ziemlich mittelmäßige Genossen; weil sie alle zwischen zwei Mauern verrannt sind – Geld und Politik! Es sind alte Pedanten, lieber Freund, mit denen man über nichts sprechen kann, über nichts was uns interessiert. Ihr Verstand ist ganz festgetrocknet oder vielmehr versumpft, wie die Seine bei Asnières.
Ach es ist ja so schwer einen Menschen zu finden, der etwas weitere Begriffe hat, bei dem man so das Gefühl einer frischen Seebrise empfindet. Ich habe einige wenige gekannt, die sind aber tot.
Norbert von Varenne sprach mit klarer aber verhaltener Stimme, die man weiter vernommen hätte im Schweigen der Nacht, hätte er sie nicht etwas gedämpft.
Er schien traurig, von einer jener traurigen Stimmungen befallen, die manchmal die Seele ergreifen, daß sie zittert, wie die Erde unter dem Frost.
Er sagte:
– Aber es kommt schließlich nicht darauf an, ob einer etwas mehr oder weniger Geist hat. Es geht ja doch alles zu Grunde.
Читать дальше