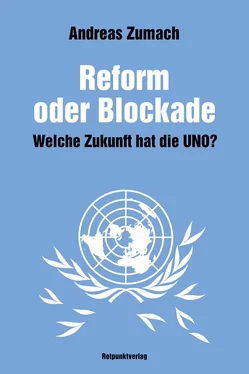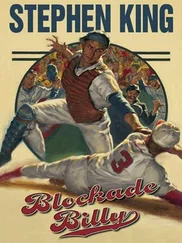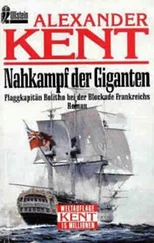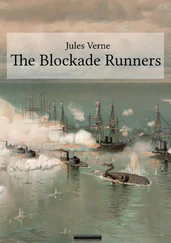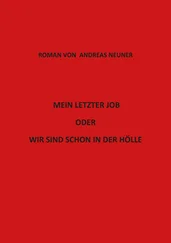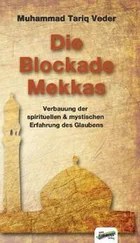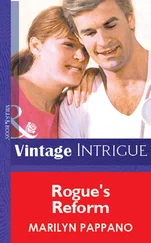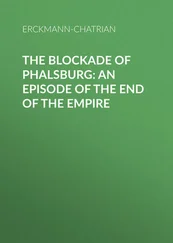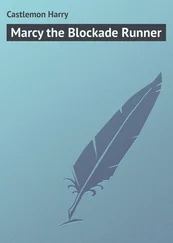1 ...7 8 9 11 12 13 ...20 –Bei der Verteilung eventueller Steuerüberschüsse bekommen Staaten, aus denen viel UNO-Treibhausgassteuergeld geflossen ist, auch einen großen Anteil der Steuerüberschüsse, um damit im Idealfall einen nationalen Marshall-Plan der Energiewende zu finanzieren und in den folgenden Jahren weniger UNO-Treibhausgassteuer entrichten zu müssen. Diese Rückerstattung der Überschüsse der UNO-Treibhausgassteuer ist geeignet, die Chancen zur Einführung derselben zu erhöhen.«
Ständige UNO-Truppe scheitert an nationalem Souveränitätsanspruch der Mitgliedstaaten
Die »Bewahrung des Friedens und der internationalen Sicherheit« ist laut UNO-Charta eine der zentralen, wenn nicht sogar die wichtigste Aufgabe der Weltorganisation. Doch zu keinem Zeitpunkt seit ihrer Gründung haben die Mitgliedstaaten auch die ausreichenden zivilen wie militärischen Mittel und Instrumente zur Erfüllung dieser Aufgabe zur Verfügung gestellt. In den ersten 45 Jahren bis zum Ende des Kalten Krieges fiel dieses Defizit weniger auf. Denn es gehörte zur politischen Logik der Ost-West-Konfrontation, dass fast sämtliche Gewaltkonflikte und Verletzungen des Friedens, an denen die USA und die Sowjetunion oder auch die beiden anderen westlichen Vetomächte des Sicherheitsrats, Frankreich und Großbritannien, in den Jahren 1945 bis 1990 beteiligt waren, für den Sicherheitsrat und damit für die gesamte UNO tabu waren.
In den übrigen Gewaltkonflikten konnten von der UNO entsandte Unterhändler in vielen Fällen erfolgreich zumindest die Vereinbarung von Waffenstillständen zwischen den Konfliktparteien vermitteln, manchmal sogar eine politische Lösung des Konflikts. 13-mal entsandte der Sicherheitsrat zwischen 1948 und 1988 Peacekeeping-Soldaten, für die sich wegen ihrer in UNO-Blau gefärbten Helme der Name »Blauhelme« einbürgerte. Derartige Peacekeeping-Missionen waren in der UNO-Charta gar nicht vorgesehen. Die Voraussetzung für ihre Entsendung und ihre Einsatzregeln wurde erst nach der ersten Mission, die 1948 zur Überwachung des Waffenstillstands zwischen Israeli und Palästinensern entsandt wurde, vom Sicherheitsrat festgelegt: Es muss ein vertraglich vereinbarter Waffenstillstand vorliegen mit einer klar definierten Waffenstillstandslinie. Beide Konfliktparteien müssen der Stationierung von UNO-Blauhelmsoldaten entlang dieser Linie vorab zustimmen. Einzige Aufgabe der Blauhelme ist es, die Einhaltung des Waffenstillstands zu überwachen. Sie sind ausschließlich zum Zwecke der Selbstverteidigung mit leichten Waffen ausgerüstet.
Alle 13 Peacekeeping-Missionen, die der Sicherheitsrat von 1948 bis 1988 entsandte, waren erfolgreich beziehungsweise sind es bis heute. Denn einige dieser Missionen dauern nach wie vor an – zum Beispiel die seit 1950 an der indisch-pakistanischen Grenze und die seit 1974 entlang der Grünen Linie zwischen dem griechischen und dem türkischen Teil Zyperns. Im Jahr 1988 wurden die Peacekeeping-Missionen der UNO mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Damit endete auch die Erfolgsgeschichte.
Von der Friedenserhaltung zur Friedenserzwingung
Nach Ende des Kalten Krieges änderte sich der Charakter der Blauhelmoperationen der UNO erheblich; es ging nicht mehr nur um Friedenserhaltung, sondern um seine Durchsetzung. Am deutlichsten zeigte sich dies zunächst in den jugoslawischen Zerfallskriegen zwischen 1991 und 1995, die sich im Wesentlichen in den beiden Republiken Kroatien und Bosnien-Herzegowina abspielten. Verlässliche Waffenstillstände kamen in diesen Gewaltkonflikten trotz aller damals gemeinsamen Vermittlungsbemühungen von UNO und EU nie zustande.
Dennoch entsandte der Sicherheitsrat ab 1992 UNO-Schutztruppen (United Nations Protection Forces, UNPROFOR) nach Kroatien und Bosnien-Herzegowina. Ihre Aufgabe war es zunächst, humanitäre Hilfstransporte nach Sarajevo und in andere damals in erster Linie von Milizen der nationalistischen Serben belagerte Städte zu begleiten. Dies gelang, wenn überhaupt, nur gegen den Widerstand der Belagerer. Später kam als Aufgabe die Bewachung der vom Sicherheitsrat zu »UNO-Schutzzonen« erklärten Städte hinzu.
Doch das Mandat, die Einsatzregeln und die Ausrüstung der Blauhelme waren völlig unzureichend. Und für die Bewachung der UNO-Schutzzonen war die Zahl der dort stationierten Blauhelme viel zu gering. Das zeigte sich besonders dramatisch, als im Juli 1995 die 300 leicht bewaffneten niederländischen Blauhelme in der UNO-Schutzzone Srebrenica von 12’000 mit schweren Waffen ausgerüsteten serbischen Angreifern überrannt wurden. Die serbischen Angreifer ermordeten in der Folge fast 8000 männliche muslimische Einwohner Srebrenicas.
Mangelndes Interesse an der Verhinderung des Völkermords in Ruanda
Bereits im Frühjahr 1994 waren in Ruanda über 800’000 Menschen einem Völkermord zum Opfer gefallen. Auch dieser Völkermord hätte bei entsprechendem Willen der UNO-Mitglieder, insbesondere der fünfzehn Staaten im Sicherheitsrat, verhindert werden können. Der Kommandeur der kleinen UNO-Blauhelmtruppe, die bis kurz vor Beginn des Völkermords in Ruanda mit einem reinen Beobachtungsauftrag stationiert war, hatte dem damaligen UNO-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali und der von seinem späteren Nachfolger Kofi Annan geleiteten Abteilung für Peacekeeping-Operationen (DPKO) umfangreiche und stichhaltige Beweise für die Planung und Vorbereitung des Völkermords der Hutu an den Tutsi übermittelt.
Boutros-Ghali und Annan legten diese Beweise dem Sicherheitsrat vor und plädierten nachdrücklich für die Stationierung einer robusten Blauhelmtruppe zwischen den verfeindeten Volksgruppen der Hutu und der Tutsi, um den drohenden Völkermord zu verhindern. Doch im Sicherheitsrat erhob sich keine einzige Hand zur Unterstützung dieser Forderung. Denn kein Mitglied des Sicherheitsrats war bereit, für eine solche Truppe eigene Soldaten, Waffen, Transportmittel oder sonstige Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. Es gab kein ausreichendes nationales Eigeninteresse, sich für die Verhinderung des drohenden Völkermords in Ruanda zu engagieren.
Der damalige US-Außenminister Warren Christopher hatte seinen für Afrika zuständigen Beamten sogar ausdrücklich untersagt, mit Blick auf Ruanda von einem drohenden »Völkermord« zu sprechen. Das, so Christophers Befürchtung, hätte die USA unter politisch-moralischen Handlungsdruck gesetzt. Denn die UNO-Konvention zur Verhinderung von Genozid (Völkermord) von 1948 verpflichtete die Vertragsstaaten zum Eingreifen.
Ruanda ist bis heute der klarste Beleg dafür, dass die UNO eine ständige Truppe benötigt. Damit sie auch dann zur Verhinderung oder Beendigung von Völkermord und von Verbrechen gegen die Menschlichkeit militärisch handlungsfähig ist, wenn es unter den Mitgliedstaaten kein ausreichendes Interesse und keine Bereitschaft gibt, UNO-Soldaten und militärische Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. Seit dem Völkermord in Ruanda gibt es eine Reihe weiterer Gewaltkonflikte insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent, bei der die UNO trotz eines entsprechenden Beschlusses des Sicherheitsrats nicht oder nur sehr unzureichend handlungsfähig war, weil die Mitgliedstaaten sich weigerten, das benötigte militärische Personal und die Ausrüstung zur Verfügung zu stellen.
Bereits vor den Völkermorden von Srebrenica und Ruanda hatte UNO-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali in seiner im Mai 1992 vorgelegten »Agenda für den Frieden« betont, dass die UNO in erster Linie verstärkte und bessere zivile Instrumente zur Bearbeitung von Konflikten benötige. Boutros-Ghali hielt allerdings auch eine ständige UNO-Truppe unter gemeinsamem Kommando des Sicherheitrats und des Generalsekretärs für unverzichtbar.
Doch da die drei westlichen Vetomächte des Sicherheitsrats, USA, Frankreich und Großbritannien, Boutros-Ghalis Vorschlag rundweg ablehnten, musste sich die Abteilung für Peacekeeping-Operationen in der New Yorker UNO-Zentrale um die »zweitbeste Lösung« bemühen. In den Jahren 1993/94 wurden sämtliche UNO-Mitgliedsregierungen ersucht, nationale »Stand-by-Kontingente« an Soldaten, Waffen, Transportmitteln oder logistischer Ausrüstung zu definieren, die der UNO im Bedarfsfall schnell zur Verfügung stehen sollten. Auf diese Weise sollte wenigstens die Planungssicherheit für Peacekeeping-Operationen erhöht werden.
Читать дальше