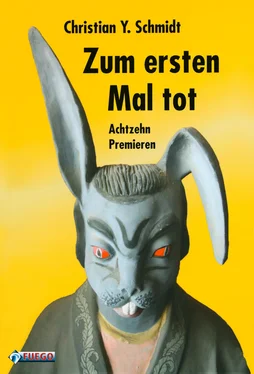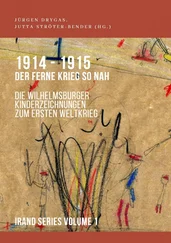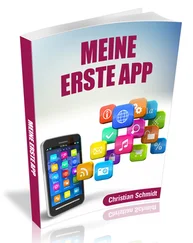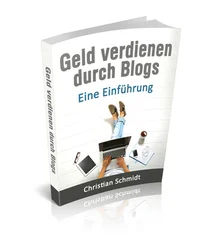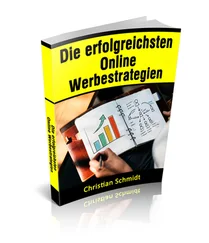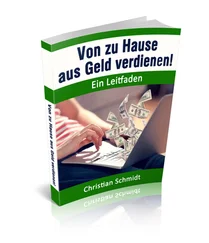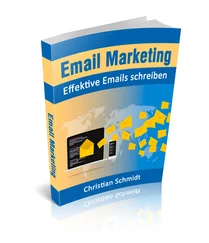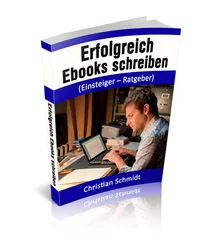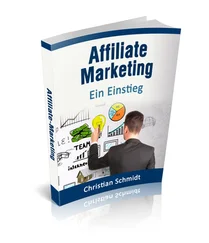Es gab auch echte Adelige unter den Patienten. Einer war Herr von Bismarck, aus der Familie des ehemaligen Reichskanzlers. Er wohnte im »Libanon«, hatte aber trotzdem seinen Nachnamen behalten. Er war hochgewachsen, ging in grünem Loden und schritt mehrmals in der Woche gravitätisch an unserem Haus vorbei. Mein Großvater war noch zu Lebzeiten des Kanzlers Bismarck geboren, und auch er war ein Diakon. Doch arbeitete mein Großvater im Garten, und stolzierte Bismarck vorbei, wurde er von meinem Großvater immer voller Hochachtung gegrüßt. Es gab noch einen anderen grüngekleideten Patienten, der in Bethel berühmt war. Das war der Polizist. Er trug eine knallgrüne, Orden geschmückte Uniform mit dazu passenden Reitstiefeln. Ab und zu machte er auch außerhalb der Anstalt kleine Ausflüge. Dann konnte man ihn irgendwo in Bielefeld auf einer Kreuzung sehen, wo er den Verkehr regelte.
Die epileptischen Patienten unterschieden sich von den Geisteskranken dadurch, dass sie von einem Moment auf den anderen mit einem großen Anfall zusammenbrechen konnten. Da es in meiner Kindheit noch keine besonders ausgeklügelten Antiepileptika gab, passierte das laufend. Mehrmals am Tag sahen wir Kinder Erwachsene, die zappelnd und zuckend auf der Straße lagen, mit Schaum vor dem Mund und verdrehten Augen. Besonders häufig schlug der epileptische Blitz ein, wenn sich ein Patient irgendwie erregte. So bekam bei einer schmissigen Predigt in den Anstaltskirchen fast jedes mal ein Patient einen Anfall. Pfleger und Mitpatienten schafften den Zuckenden dann möglichst schnell aus dem Kirchenschiff und trugen ihn auf eine Liege in einen Raum, der extra für die Anfälle gebaut war. Das war so normal, dass niemand weiter davon Notiz nahm. Nur für uns Kinder war so ein Anfall immer eine willkommene Abwechslung in den öden Gottesdiensten.
Viele Epileptiker trugen damals einen ledernen Sturzhelm, der sie vor Verletzungen bei einem Anfall bewahren sollte. Ein nicht besonders vorteilhaft wirkendes Kleidungsstück. Natürlich machten wir Kinder uns darüber lustig. Auch sonst amüsierten wir uns über die Patienten, obwohl uns das die Eltern streng verboten hatten: »Die Kranken sind Menschen wie wir. Man darf nicht über sie lachen.« Aber weil sich die Patienten eben so komisch benahmen und wir Kinder waren, hörten wir nicht auf sie. Wir äfften den Gang, die Anfälle und ihre seltsame Art zu sprechen nach, oder wir versteckten uns in Bethels kleinen Wäldern hinter Bäumen und sprangen dann hervor, um sie zu erschrecken. Besonders gerne ärgerten wir den liebestollen Dieter von Brockensammlung. Einmal regte er sich darüber so sehr auf, dass er neben seinem Karren zu Boden ging und krampfte. Da kriegten wir es doch mit der Angst zu tun und liefen schnell nach Hause. Ich machte mir den ganzen restlichen Tag große Sorgen. Doch am nächsten Tag stand Dieter wie gewohnt an der Schule und röhrte die kleinen Schulmädchen an. Er hatte offenbar vergessen, was passiert war.
Wir Kinder lebten gerne in Bethel. Da Kinder Geschenke Gottes waren, hatten die Brüder alle große Familien. Sechs oder sieben Kinder waren keine Seltenheit. Wir waren vier Geschwister, und das Haus, in dem wir wohnten, stand allen anderen Kindern immer offen. Wir tobten auch durch die Häuser und Gärten der anderen Familien. Uns gefiel auch, dass Bethel damals noch sehr ländlich war. Es gab mehrere Bauernhöfe, auf denen auch Patienten arbeiteten, die dazu in der Lage waren. Der schöne Siegfried und sein hässlicher Kumpel fuhren täglich mit einem Pferdefuhrwerk die Anstaltsstraßen ab, um in großen stinkenden Tonnen Essensreste einzusammeln, die an die Schweine Arafnas verfüttert wurden. Auch Enon war ein Bauernhof und den Schweinen von Arimathia warfen wir im Herbst Eicheln und Kastanien in ihre Koben, die direkt an unserem Schulweg lagen.
Patienten arbeiteten auch in der anstaltseigenen Bäckerei oder in der Ziegelei, von der eine kleine Schmalspurbahn zur anstaltseigenen Tongrube zuckelte. Das Ziel der Anstaltsgründer war es gewesen, Bethel so autark wie möglich zu machen. Deshalb hatte man nach und nach auch noch eine Schusterei gebaut, eine große Gärtnerei, ein Milchgeschäft, in der man lose Milch und Butter kaufen konnte, eine Schlosserei und eine Schmiede, die den Namen Gilgal trug. In der Bibel war das der Ort, an dem König Saul gesalbt wurde, später wurde er ein Hort der Abgötterei. Hier lungerte ich manchmal herum und beobachtete Hengste mit erigiertem Penis, die beschlagen wurden. Ich wunderte mich über den Schlauch, der aus ihnen herausragte, und ich dachte, diese Pferde seien irgendwie kaputt. Es schien aber weder sie selbst noch irgendeinen anderen zu stören, und als ich meiner Mutter das Problem erklären wollte, verstand sie es nicht.
In der Mitte der Anstalt stand das große Bethelkaufhaus. Es hieß Ophir nach dem sagenhaften Goldland, aus dem König Salomo Gold, Sandelholz und Elfenbein holen ließ, um seine Prachtbauten in Jerusalem zu errichten. Hier wie in den anderen Geschäften konnte man mit Bethelgeld bezahlen, einer Parallelwährung, die bis heute in ganz Deutschland einzigartig ist. Das Geld wurde nur an Patienten und in Bethel Beschäftigte ausgegeben, die es in der örtlichen Filiale der Sparkasse tauschen konnten. Es war ein guter Tausch, denn für 100 Mark Bundesgeld gab es 105 Mark Bethelgeld. Die Anstaltsleitung hatte diese eigene Währung eingeführt, damit der Lohn der Angestellten und das Taschengeld der Patienten in Bethel blieb; außerdem sollte wohl verhindert werden, dass sich Patienten und die auf dem Lindenhof verwahrten »Tippelbrüder« außerhalb der Anstalt mit Stoff versorgen konnten. Natürlich kamen sie trotzdem an ihren Schnaps, denn einige Geschäfte direkt an der Grenze Bethels nahmen auch die betheleigene Währung an. Offenbar gab es dunkle Kanäle, die benutzt wurden, um die Scheine zurückzutauschen.
Ich liebte unser Bethelgeld, und bekamen wir Besuch von draußen, gab ich damit an. Besonders gut gefiel mir, dass es neben Eine-Mark- und Zwei-Markscheinen sogar Fünfzig-Pfennigscheine gab, denn so hatte ich als kleiner Taschengeldempfänger immer auch Papiergeld im Portemonnaie. Ich hätte gerne noch mehr gehabt, und eigentlich wäre das auch nicht schwer gewesen. Unser Vater hatte nämlich die Verbrennung alter Bethelgeldscheine zu überwachen. »Ach Papa«, bettelten wir, »bring uns doch einfach ein paar mit. Das merkt doch keiner.« Doch der Vater sagte nur: »Ihr wisst doch, dass Gott alles sieht«, und ließ sich nicht erweichen.
Außer den besonderen Bewohnern und dem Bethelgeld gab es noch ein paar Dinge, die in Bethel anders waren als im Rest der Welt. Es existierte eine eigene Post, die sogenannte Botenmeisterei, wo das Verschicken von Briefen innerhalb Bethels nichts kostete. So sparte man vor allem beim Versenden von Todesanzeigen. Auch das Telefonieren war umsonst, was wir Kinder weidlich ausnutzten. Waren die Eltern aus dem Haus, riefen wir Leute mit komischen Namen an und terrorisierten sie. »Ist da Frau Küth?« »Ja.« »Tüt, tüt, tüt«, und das ungefähr zwanzig Mal am Tag. Da die Telefongespräche auf keiner Rechnung auftauchten, kam uns nie ein Erwachsener auf die Spur. Es gab auch einen kostenlosen Bethelbus, doch der fuhr nicht an unserem Haus vorbei, so dass wir ihn kaum nutzten. Was fehlte, war lange Zeit ein eigener Rundfunksender, doch als man das bemerkte, gab es den dann plötzlich auch. Der Betheler Krankenhausfunk übertrug per Kabel die Gottesdienste aus den Betheler Kirchen in die Pflegehäuser, und ab Mitte der Siebziger gab es zwischendurch religiöse Popmusik, bevorzugt von der anstaltseigenen Fürsorgezöglingsband »Wir« aus Freistatt, Bethels Teilanstalt im Moor.
Bethel hätte eigentlich nur noch eigene Briefmarken drucken müssen, dann wäre es glatt als ein Zwergstaat wie Monaco, San Marino oder eben der Vatikan durchgegangen. Tatsächlich hörte ich immer mal wieder das Gerücht, es hätte nach Ende des Zweiten Weltkriegs Pläne gegeben, Bethel aus Westdeutschland heraus zu trennen und in die Unabhängigkeit zu entlassen. Das aber ist wahrscheinlich Blödsinn. Diese Anstalt war ja nicht von dieser Welt. Ich wusste lange nicht, womit ich diesen Ort vergleichen sollte, bis ich irgendwann die Fernsehserie »The Prisoner« mit Patric McGoohan sah. Hier wird ein Haufen seltsamer Gestalten in einem nur »The Village« genannten höchst autarken Dorf festgehalten, in dem seltsame Regeln gelten und aus dem es praktisch kein Entrinnen gibt. Allerdings glaubte ich, dass ich, wenn ich nur wollte, »der Anstalt« jederzeit entkommen konnte. Wie sich später herausstellen sollte, war das ein Irrtum.
Читать дальше