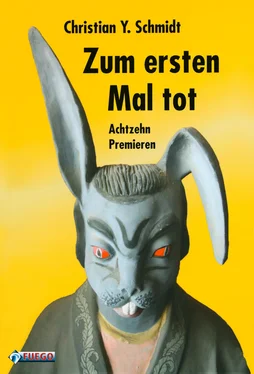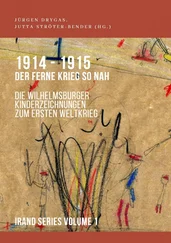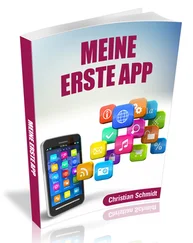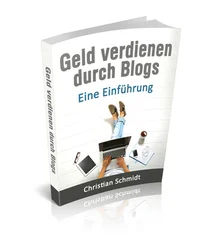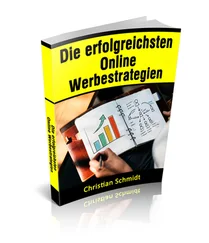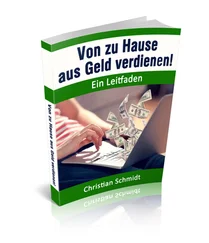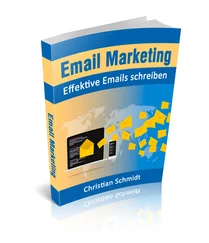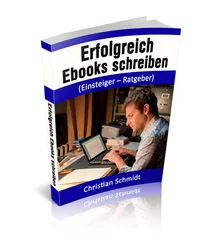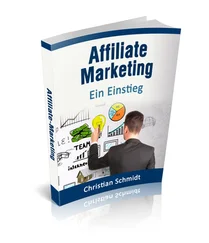Nach diesem Misserfolg ließ mich der Tod ein paar Jahre in Ruhe. Er meldete sich zurück, als ich die Fünfzig gerade überschritt. Ich glaube, unser grauer Betreuer liebt die Dekade zwischen Fünfzig und Sechzig ganz besonders. Da geht es ja auch langsam mit dem großen Sterben los. Ich bekam einen Hirntumor, der aber verschwand, nachdem man mich dreimal in die MRT-Röhre gesteckt hatte. Der Tumor verwandelte sich in amyotrophe laterale Sklerose. Ich hatte alle Symptome dieser geheimnisvollen Krankheit, die fast immer innerhalb weniger Jahre zum Tode führt: Muskelschäche, Schwindel, Krämpfe und Kribbeln in den Beinen. Sie passte auch gut zu mir. Es waren bereits etliche andere Prominente an ihr gestorben. Der Schauspieler David Niven, Charlie Mingus oder der Kanzlermaler Jörg Immendorf. Auch Stephen Hawking leidet an der VIP-Krankheit. Ich las sofort ohne Unterbrechung alles über ALS, bis ich schließlich auch alles wusste, unter anderem, dass ich die Krankheit nicht haben konnte. Damit verschwanden sämtliche Symptome. So ähnlich war es auch bei meiner Lungenfibrose, dem Lupus oder dem Pankreastumor. Inzwischen glaube ich, je älter ich werde, desto unsterblicher werde ich.
Natürlich schmeckt das dem feinen Herrn Tod nicht. Und darum brütet er sicher schon die nächste Schweinerei aus. Ich vermute, er spekuliert darauf, dass er mich eines Tages überlistet. Doch das wird nicht passieren. Ich bin auf der Hut und merke jedes Mal, was er im Schilde führt. Ich weiß, er hofft darauf, dass ich unaufmerksam werde, um dann plötzlich richtig zuzuschlagen. Aber ich habe keine Angst. Denn selbst, wenn es ihm irgendwann gelingen sollte, was sollte das schon für ein Sterben sein? In ein paar hundert Jahren gehe ich eines Abends mit einem leichten Zittern zu Bett. Und am nächsten Morgen wache ich einfach nicht mehr auf. Vollkommen unspektakulär. Es wird für mich Routine sein, ein alter Hut, so langweilig wie die Reden deutscher Bundespräsidenten. Was aber ist wohl mein letzter Gedanke? Ich glaube, so etwas wie: Ach, könnte ich doch nur so sterben wie beim allerersten Mal. So aufregend und gesund.
Epileptikeradel und schwarze Schwestern
Zum ersten Mal draußen
(33 Jahre)
Ich bin zwischen den grünen Bergen von Garizim und Morija aufgewachsen. Seitdem ich denken konnte, blickte ich aus dem Fenster unserer Küche auf Bethanien, dem »Haus der Armen«, einem Flecken bei Jerusalem. Wir spielten in den Gärten Magdalas am See Genezareth, und auf dem Weg zur Schule überwand ich täglich den Berg Nebo, auf dem Moses starb, nachdem ihm Gott das Land der Verheißung gezeigt hatte. Passend zu dieser Geschichte stand hier oben eine Kapelle, aus der es immer süßlich roch, weil in ihrem kühlen Keller die Leichen aufgebahrt wurden, die auf ihre Bestattung warteten. An manchen Sommerwochenenden zogen wir mit unserer Mutter Richtung Enon und pflückten schwarze Brombeeren. In dieser Gegend taufte einst Johannes, denn es gab viel Wasser hier. Bei Enon stand auch das Haus Arafnas. Auf dessen Tenne hatte König David vor Zeiten einen Altar errichtet, aus dem dann später der große Tempel wurde. Ganz hinten im Wald, hinter den drei grünen Gaskugeln, erhob sich hoch auf einem Berg Salem. Das war das Ende unserer Welt.
Diese Welt trägt den Namen Bethel, was auf Hebräisch so viel wie das »Haus Gottes« heißt. Dieses Bethel aber liegt nicht, wie man meinen könnte, in Israel, sondern ist heute ein Teil von Bielefeld. Damals gehörte es noch nicht zur Stadt, sondern war eine fast selbstständige Anstalt, die etwa 8.000 Epileptiker und ein paar Tausend Geisteskranke beherbergte. Die Bezeichnung »Anstalt« führt allerdings in die Irre, da man sich darunter ja gemeinhin ein klar begrenztes, ja ummauertes Gelände vorstellt. Doch diese Grenzen fehlten.
Bethel war eine protestantische Einrichtung, was die biblischen Namen aller hier errichteten Häuser und Landschaftselemente erklärt. Auch alle Menschen, die in den beiden Betheltälern lebten, waren stark vom Protestantismus geprägt. Wahrscheinlich gab es hier keine fünf Katholiken. Bethel war so etwas wie der protestantische Vatikan. An der Spitze der gesellschaftlichen Ordnung stand eine ganze Schar von Pfarrern, denen ein kleines Bataillon von Diakonen zuarbeitete. Zu denen zählte mein Vater. Die Pfarrer und Diakone waren Angehörige einer Bruderschaft. Uns Kindern erschlossen sich die Hierarchien erst langsam. Wir fragten immer, ob jemand, der uns besuchte oder den wir auf der Straße trafen, auch ein »Bruder« war oder aber bloß ein »Herr«. »Ist ein Bruder was Besseres?«, fragte ich irgendwann meine Mutter. Die verneinte. Doch das stimmte nicht. Die Herren waren so etwas wie die zivilen Angestellten Bethels und hatten fast immer Vorgesetzte, die sich untereinander mit Bruder ansprachen.
Auch die Frauen in Bethel gehörten unterschiedlichen Klassen an. Es gab welche wie meine Mutter, die mit Männern verheiratet waren. Und es gab Frauen, die das nicht durften. Das waren die Diakonissen. Sie trugen eine pechschwarze Tracht und weiße gestärkte Hauben, unter denen sich eine einheitliche Mittelscheitelfrisur verbarg. Diese Frauen, die niemals Mütter werden würden, gehörten absurderweise einem Mutterhaus an. Sie wurden mit Schwester angeredet und arbeiteten in den Pflegehäusern Bethels. Vor den Schwestern hatte ich Angst. Sie hatten etwas Steifes, Soldatisches an sich, ja manche schienen mir von Grund auf böse. Ob sie über oder unter den verheirateten Frauen standen, war schwer zu sagen. Eher bildeten sie eine Parallelgesellschaft in der Anstalt. Letztlich aber waren auch sie den Pfarrern Untertan. Einer stand an der Spitze des Mutterhauses und wurde von den Schwestern Vater genannt.
Am unteren Ende der gesellschaftlichen Skala befanden sich die Epileptiker und Geisteskranken. Sie hießen einfach: die Patienten oder Kranke. Sie mussten sogar in der Kirche auf getrennten Bänken sitzen, so wie die Schwarzen zur Zeit der so genannten Rassentrennung in den USA. Die Kränksten bekam man gar nicht zu sehen. Sie lagen auf Torfbetten in dunklen, vor über hundert Jahren gebauten Pflegehäusern, in denen es nach Scheiße, Pisse und Großküchenessen roch und aus denen manchmal fürchterliche Schreie drangen. Nur einmal betrat ich das Innerste eines solchen Hauses. Es war bei einem Martinssingen. Die Schwestern hatten uns Kinder hineingelassen und dann das Licht gelöscht, damit unsere Laternen besser zur Geltung kamen. Ich stand am Ende eines Bettes und sah im flackernden Licht ein stöhnendes Wesen mit aufgerissenem Mund und offenem Rücken vor mir liegen. Das Wesen hatte das Gesicht zu einem breiten Grinsen verzogen und ich sang tapfer: »Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen.«
Lustiger war der Patientenadel, den wir täglich auf der Straße trafen. Ernst von Tabor, der schöne Siegfried von Arafna oder Dieter von der Brockensammlung. Das jeweilige Pflegehaus, in dem sie wohnten, war Teil ihres Namens geworden; ihren echten Nachnamen kannte keiner. Dafür war jeder von ihnen etwas Besonderes. Ernst von Tabor trug immer einen Haufen Papiere mit sich herum und einen Dirigentenstab. Erklang irgendwo Musik, stellte er sich vor die Quelle und begann zu dirigieren, auch wenn es nur ein Radio war. Gegen Ernst war Karajan ein Amateur. Dieter von der Brockensammlung schob einen Handkarren durch die Anstaltsstraßen, mit dem er Pappkartons und anderes Verpackungsmaterial einsammelte. Am liebsten aber er hing er an einem Schulhof herum, um dort mit seiner immer zu lauten, kehligen Stimme blutjunge Mädchen anzusprechen. Und dann war da noch ein alter Mann mit wenigen grauen Haaren, den wir nur als »den Kater« kannten. Er begrüßte jeden auf der Straße mit einem lauten, lang gezogenen »Miau«. Er war bei den Erwachsenen sehr beliebt, weil er das absolute Gehör hatte. Für ein paar Mark stimmte er die Klaviere in der Anstalt, auch bei uns kam er dazu einmal im Jahr vorbei. Uns Kindern war der Graue suspekt. Er tätschelte uns die Wangen etwas zu lange und fasste uns auch anderen Stellen manchmal seltsam an.
Читать дальше