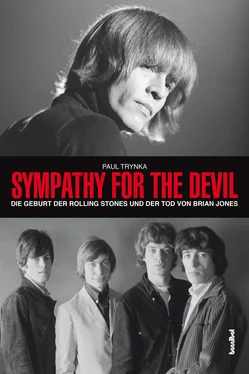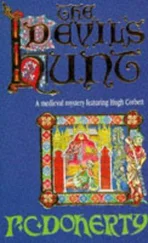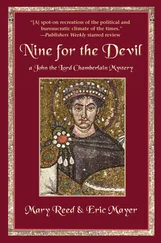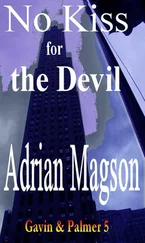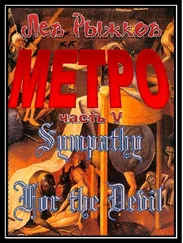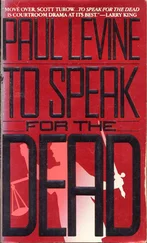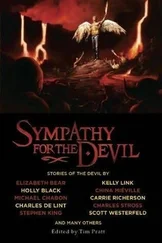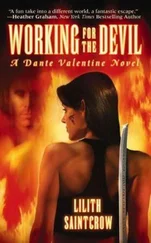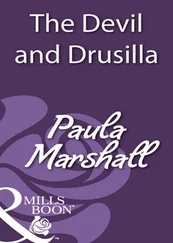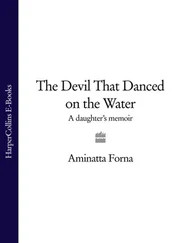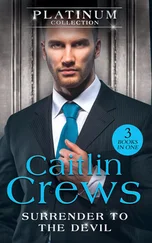Ein weiterer Eckpfeiler der Musik von Brian Jones entstand 1961, als er das Album King Of The Delta Blues Singers von Robert Johnson mit nach Haus brachte. Die Platte mit 16 Tracks – zusammengestellt vom „Musikologen“ Frank Driggs – wurde eines der Schlüssel-Artefakte des britischen Blues, von Keith Richards mit fast schon mystischen Tönen gelobt, der Brians Scheibe in der Edith Grove hörte (wo sich beide eine Wohnung teilten). Im Selkirk House spielte Brian die Platte rauf und runter. Nach der Lektüre der Artikel von Paul Oliver in der Jazz Monthly, einem Pionier der Erforschung des frühen Blues, kaufte er sich kurz nach Veröffentlichung eine Ausgabe von dessen beeindruckendem Standardwerk Blues Fell This Morning. „Er spielte nicht nur das Zeug“, meint Keen. „Er las auch darüber. Es war faszinierend.“
Johnsons Musik entfaltete sich zum Leitmotiv von Brians Leben. Die kurze Lebensdauer des Bluesman umgaben Mythen, und sie schien dunkle Energie zu verbreiten. Johnson war der Mann, der ihm bekannten Musikern wie zum Beispiel Son House erzählte, dass er seine geradezu teuflischen Gitarrenfähigkeiten an den „Crossroads“ erlernt hatte, einer nicht näher bezeichneten Straßenkreuzung in den Tiefen Mississippis. Dort traf er einen „Schwarzen Mann“, der seine Gitarre nahm und sie neu stimmte. Der „Schwarze Mann“ war, wie einige Gelehrte vermuten, eine Repräsentation des alten afrikanischen Gottes Elegua oder Legba – einer Manifestation des Teufels. Für Brian, der den Wert von Olivers bahnbrechender Recherche unmittelbar erkannte, stellte das eine durchschlagende Geschichte dar.
Doch der Crossroads-Mythos entbehrt nicht jeglicher Grundlage. Robert Johnson hatte die Geschichte zweifellos aufgepeppt, um Musikerkollegen zu beeindrucken und gottesfürchtige Christen zu schockieren. Sein Freund Honeyboy Edwards hörte Johnsons Erzählung und rückte sie mit den Worten zurecht: „Robert war ein totaler Aufschneider.“ Allerdings bekamen auch Honeyboy und andere die Präsenz des Teufels in Mississippi der Dreißigerjahre des letzten Jahrhunderts zu spüren, jedoch in einer speziellen Ausprägung. Ein schwarzer Mann, der die Straßen mit einer Gitarre bereiste, wurde oft zum Opfer eines unverzüglichen Gefängnisaufenthalts, und es konnte sogar noch schlimmer kommen: Musiker, die vor dem weißen Mann nicht mit einem untertänigen „Yes, Sir – No, Sir“ krochen, starrten allzu häufig in die Mündung des Colts eines Gesetzeshüters. Viele von ihnen wurden von ihren Familien geächtet, da sie sich für den Blues entschieden, also die Teufelsmusik, und nicht für den gottgefälligen Gospel. Brian war ein Pionier, vermutlich der erste britische Musiker, der sich Johnsons Mythos und seiner Story bediente. Zum Vergleich: Während Brian in die dunkle Welt des Robert Johnson eintauchte und per Anhalter den Südwesten Großbritanniens auf der Suche nach einem Musiker durchquerte, der sich mit ihm die Bühne teilte, sang Mick Jagger im Wohnzimmer in Dartford Buddy-Holly-Songs, um ein Publikum von Muttis zu bezaubern.
In späteren Jahren war es für die Brian überlebenden Musiker der Stones, wie beispielsweise Charlie Watts, wichtig, ihn auf eine eklige Art als Mittelschichtjunge aus Cheltenham herabzuwürdigen: „Er war ein angeberischer kleiner Bengel und stammte aus Cheltenham. Sagt das nicht schon alles?“ Einige Kritikpunkte waren berechtigt, andere glichen einem konfuzianischen Dilemma: Wir hassen einen Mann, der uns einen Gefallen erwiesen hat. Brian Jones war nicht nur die musikalische Inspiration der Rolling Stones, sondern zugleich Symbol ihrer schwarzen Magie. Er war der Stone, den etwas Dunkles umgab. Auch andere Aspekte seiner Persönlichkeit, wie die Sexualität, muteten verhängnisvoll an. Barry Miles erinnert sich, dass es in dem respektablen und höflichen Cheltenham einen Buchhändler gab, der seine Kunden mit den Werken von Marquis de Sade versorgte – Werke, die während der Ära der auch von Brian inspirierten Gegengesellschaft der Sechziger verschlungen wurden, die aber 1961 mehr als exotisch wirkten. „Brian kannte de Sade“, bestätigt Miles, „ich glaube, sogar schon in Cheltenham.“
Cheltenham … das angeblich vornehme Provinzstädtchen entpuppte sich als Zentrum einer Reihe verruchter Aktivitäten. Aufgrund der Rolle als Basis des traditionellen Jazz fungierte Cheltenham zudem als Gaststadt für eine revolutionäre Blues-Performance, als Chris Barber, der bei einigen Gigs 1959 mit Muddy Waters auftrat, sich mit der Hilfe von Alexis Korner am elektrischen Blues versuchte. Korner lässt sich als eine faszinierende Persönlichkeit beschreiben und wurde zu einer der Schlüsselfiguren in Brians Leben. Der Mann, der auf australische, jüdische und griechische Vorfahren zurückblicken konnte, ergatterte 1947 mit viel Glück einen Job beim British Forces Network und entdeckte wenige Jahre später den Blues durch Leadbelly. Innerhalb eines Jahres spielte er Gitarre in einer traditionellen Jazzband, der auch Barber angehörte. Barber hatte seine Hinwendung zu Jazz und Blues dank einer weggeworfenen Biografie des Jazz-Klarinettisten und Drogenkonsumenten Mez Mezzrow begonnen, die er auf einem Müllplatz der US-Air-Force gefunden hatte. Die beiden schlossen sich 1961 erneut zusammen und sollten retrospektiv als die wichtigsten britischen Verfechter des Blues gelten, trotz ihrer allgemein unvereinbaren Persönlichkeiten. „Chris leitete eine Jazzband, wohingegen Alexis den traditionellen Jazz nun wirklich nicht mochte“, erinnert sich Korners Frau Bobbie. „Chris zeichnete sich als erstklassiger Geschäftsmann aus, Alexis als ein fürchterlicher. Die beiden ähnelten sich überhaupt nicht.“
Trotz aller Unterschiede erwiesen sich Barber und Korner als ausschlaggebende Katalysatoren. Brian hatte Korners Aktivitäten mit beinahe schon religiösem Eifer auf den Seiten des Jazz Journal verfolgt. Als Barber und seine Band ein Konzert in der Stadthalle von Cheltenham für den 10. Oktober 1961 ankündigten, stand Brian in den Startlöchern. Hier lag seine Chance, zum Herzen der sich noch im Embryonalstadium befindenden Blues-Szene Großbritanniens vorzudringen.
Brian sicherte sich Dick Hattrell und John Keen zur moralischen Unterstützung. Dann sagte Barber den Programmteil an, bei dem Korner im Vordergrund stand. „Brian und ich schrien uns die Lunge aus dem Hals!“, meint Dick. „Ich glaube, wir waren die einzigen dort, die je etwas von ihm gehört hatten.“
Brian konnte problemlos zum Backstage-Bereich gelangen, wo er direkt den Chef vom Dienst, Barber, ansprach. Die beiden plauderten über gemeinsame Bekannte, erzählt Barber und bezieht sich damit vermutlich auf Bill Nile. „Er wusste eine Menge über das Geschäft, wusste genau, was er tat. Meiner Meinung nach war er ein sehr netter Junge. Sehr ernst, was die Musik anbelangte. Doch ich überließ Alexis das Gespräch mit ihm, da er ja der Bluesman war.“
Die drei Freunde schleppten Korner ins Patio, einen von Brians Lieblingsclubs. „Dort erzählte uns Alex, dass er eine neue Band aufbaut, um die Musik von Muddy Waters zu spielen“, erklärt Dick. „Und dass sie in einem neuen Club ihren Einstand geben wollten. Die Antwort war klar: ‚Wir werden da sein.‘“ Bei diesem Gespräch erzählte Brian von seiner Absicht, nach London zu ziehen, um Blues zu spielen. Korners Reaktion war sehr aufschlussreich. Wie John Keen mitteilt, hielt der Vater des britischen Blues Brians Plan für regelrechten Schwachsinn. „Er sagte zu Brian: ‚Geh bloß nicht nach London! Das ist nicht gut, dort wirst du es nie schaffen. Da ist alles viel zu kommerziell – dieser Blues-Stil wird niemals populär werden.‘ Brian zeigte sich von der Aussage unbeeindruckt. In manchen Belangen war er zuversichtlich und überaus willensstark.“
Trotz der Überzeugung, dass der Blues niemals im Mainstream münden würde, wurde Alexis Korner, damals 33, Brians wichtigster Förderer. Chris Barber und sein Manager Harold agierten gemeinsam wie eine gut geölte Geschäftsmaschine, die bedeutende Veranstaltungsorte wie das Marquee oder Festivals wie das National Jazz and Blues Festival etablierten. Im Gegensatz dazu war Korner eher eine Vaterfigur, ein väterlicher Freund. Das Apartment in der Moscow Road in Bayswater, Westlondon, das er mit seiner Frau Bobbie, selbst ein wichtiger und engagierter früher Blues-Fan, sowie dem Schriftsteller Charles Fox bewohnte, wurde zu einem Künstlertreff, einem Anziehungspunkt für die Bohème. Zu den ersten jüngeren Besuchern in der Moscow Road gehörten Brian Jones und Dick Hattrell.
Читать дальше