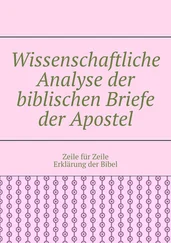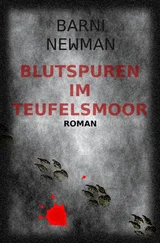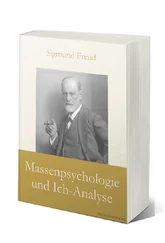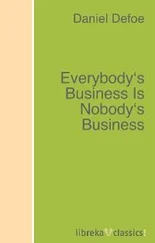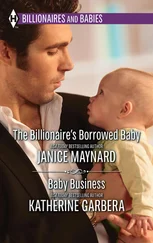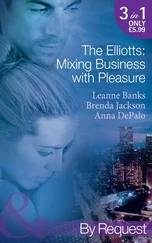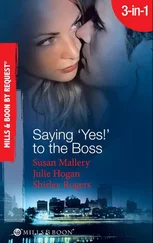1.4.3.5.9 Scamper
1.4.3.6 Überkreuz-Workshop
1.4.4 Zusammenfassung
1.5 Empfehlung
1.5.1 Überblick
1.5.2 Entscheidungsanalyse
1.5.2.1 Nicht-monetäre Ergebnisse
1.5.2.2 Kapitalwert, Barwert, Discounted Cashflow
1.5.2.3 Interner Zinsfuß
1.5.2.4 Amortisationsdauer
1.5.2.5 Durchschnittliche Rendite
1.5.2.6 Nutzwert-Analyse
1.5.2.7 Kosten-Nutzen-Analyse
1.5.3 Risikoanalyse
1.5.3.1 Risikoportfolio
1.5.3.2 Risikotabelle
1.6 Business Case
1.7 Zielgruppe
1.8 Handlungskompetenz
1.8.1 Einführung
1.8.2 Geschäftsverständnis
Literatur zu Kapitel 1
2 Requirements Engineering
2.1 Einleitung
2.2 Vorbereitung
2.2.1 Anforderungsquellen
2.2.2 Einflussfaktoren bei der Anforderungsermittlung
2.2.2.1 Menschliche Einflussfaktoren
2.2.2.2 Organisatorische Einflussfaktoren
2.2.2.3 Fachliche/inhaltliche Einflussfaktoren
2.2.3 Ermittlungsinhalte
2.2.3.1 Checkliste mit grundlegenden Fragen
2.2.3.2 Würfel der Ermittlungsinhalte
2.2.4 Wahl der Erhebungstechniken
2.3 Anforderungsermittlung
2.3.1 Erhebung durchführen
2.3.1.1 Befragungstechniken
2.3.1.1.1 Checkliste
2.3.1.1.2 Gliederung
2.3.1.1.3 Interview
2.3.1.1.4 Workshop
2.3.1.2 Beobachtungstechniken
2.3.1.2.1 Fremdbeobachtung
2.3.1.2.2 Selbstbeobachtung
2.3.1.3 Weitere Techniken
2.3.2 Annahmen, geschäftliche und technische Restriktionen identifizieren
2.3.2.1 Annahmen
2.3.2.2 Geschäftliche Restriktionen
2.3.2.3 Technische Restriktionen
2.3.3 Erhebung dokumentieren
2.3.3.1 User-Story
2.3.3.2 Story-Dekomposition
2.3.3.3 Story-Elaboration mit Abnahmekriterien
2.3.3.4 Story-Map
2.3.3.5 Glossar
2.3.4 Ergebnisse der Erhebung bestätigen lassen
2.4 Anforderungspriorisierung
2.4.1 Überblick
2.4.2 Priorisierungskriterien
2.4.3 Priorisierungstechniken
2.4.3.1 MoSCoW
2.4.3.2 Big-Wall-Verfahren
2.4.3.3 Planning Poker
2.4.3.4 Business Value Game
2.4.3.5 Präferenzmatrix
2.4.3.6 Abstimmung
2.4.3.7 Kano-Modell
2.4.3.8 Kano-Analyse
2.4.3.9 Magic Estimation
2.4.3.10 Team Estimation Game
2.4.3.11 Zusammenfassung
2.5 Strukturierung
2.5.1 Möglichkeiten der Strukturierung
2.5.2 Techniken der Spezifizierung und Modellierung
2.5.3 Kriterien zur Auswahl von Dokumentationstechniken
2.5.4 Prinzipien der Dokumentation
2.5.5 Zusammenfassung
2.6 Spezifizierung
2.6.1 Hauptprobleme mit Anforderungen in natürlicher Sprache
2.6.2 Funktionale versus nicht-funktionale Anforderungen
2.6.3 Funktionale Anforderungen
2.6.3.1 Kurzschema für universelle funktionale Anforderungen
2.6.3.2 Schema für nicht-universelle funktionale Anforderungen
2.6.3.3 Optionale Ergänzungen
2.6.3.4 Abnahmekriterien für funktionale Anforderungen
2.6.4 Nicht-funktionale Anforderungen
2.6.4.1 Kategorien nicht-funktionaler Anforderungen
2.6.4.2 Nicht-funktionale Anforderungen herleiten
2.6.4.3 Nicht-funktionale Anforderungen dokumentieren
2.6.5 Zusammenfassung
2.7 Modellierung
2.7.1 Eigenschaften von Modellen
2.7.2 Kontextdiagramm
2.7.3 Use-Case-Diagramm
2.7.4 Use-Case-Beschreibung
2.7.5 Prozessmodellierung
2.7.5.1 BPMN-Diagramm
2.7.5.2 Weitere Notationen zur Prozessmodellierung
2.7.5.2.1 Folgeplan
2.7.5.2.2 Ereignisgesteuerte Prozesskette
2.7.5.2.3 UML-Aktivitätsdiagramm
2.7.5.3 Vorgehen und Tipps
2.7.6 Datenmodellierung
2.7.7 Prototyping
2.7.8 Weitere Modelle
2.7.9 Zusammenfassung
2.8 Verifizierung, Validierung
2.8.1 Überblick
2.8.2 Verifizierung
2.8.2.1 Statische Verifizierungstechniken
2.8.2.2 Dynamische Verifizierungstechniken
2.8.2.3 Dokumentationsabgleich
2.8.3 Validierung
2.8.3.1 House of Quality (HoQ)
2.8.3.2 Quality Function Deployment (QFD)
2.8.4 Zusammenfassung
2.9 Genehmigung
2.10 Anforderungsmanagement
2.10.1 Überblick
2.10.2 Anforderungen weiterverwenden
2.11 Anforderungsdokument
2.11.1 Ausrichtung eines Anforderungsdokuments
2.11.2 Gliederung eines Anforderungsdokuments
2.11.3 Lastenheft und Pflichtenheft
2.12 Zielgruppe
2.13 Handlungskompetenz
Literatur zu Kapitel 2
3 Lösungseinführung
3.1 Einleitung
3.2 IT
3.2.1 Zuordnung von Anforderungen
3.2.2 Transitionsanforderungen
3.3 Kultur
3.4 Ziele und Struktur
3.4.1 Prozesse
3.4.2 Lösungsbewertung und Leistungsüberprüfung
3.4.2.1 Kennzahlen
3.4.2.2 Ist-Werte
3.4.2.3 Maßnahmen
3.5 Lösung
3.5.1 Checkliste
3.5.2 Dokumente
3.6 Zielgruppe
3.7 Handlungskompetenz
Literatur zu Kapitel 3
4 Business-Analyse-Planung und -Steuerung
4.1 Einleitung
4.2 Planung
4.2.1 Überblick
4.2.2 Stakeholder-Analyse
4.2.2.1 Ablauf der Stakeholder-Analyse
4.2.2.2 RACI-Matrix und Stakeholder-Tabelle
4.2.2.3 Stakeholder-Portfolio
4.2.2.4 Persona
4.2.3 Aufgaben
4.2.3.1 Aufgaben und Ergebnisse
4.2.3.2 Zeitaufwand
4.2.3.3 Kommunikation
4.2.4 Anforderungsmanagement
4.2.4.1 Anforderungsrepositorium
4.2.4.2 Verfolgbarkeit (Traceability)
4.2.4.3 Anforderungsattribute
4.2.4.4 Anforderungspriorisierung
4.2.4.5 IT-Change-Management
4.3 Ist-Erfassung, Diagnose, Steuerung
4.3.1 Überblick
4.3.2 Aufgabenbericht
4.3.3 Taskboard
4.3.4 Gruppenprozessanalyse
4.4 Zusammenfassung
Literatur zu Kapitel 4
5 Business-Analyse in agilen Kontexten
5.1 Einleitung
5.2 Business-Analysten in Scrum
5.2.1 Scrum im Überblick
5.2.2 Rollen in Scrum
5.2.3 Einsatz von Business-Analysten in Scrum
5.3 CONNY-Prinzip für agile Business-Analyse
5.3.1 Collaborate and improve continuously
5.3.1.1 Collaborative Games
5.3.1.2 Retrospektive
5.3.2 Only the customer counts
5.3.3 Negotiate what is valuable to the customer
5.3.4 Not feasible = not necessary
5.3.4.1 Planungs-Workshop
5.3.4.2 Schätzung
5.3.5 You should not waste
Literatur zu Kapitel 5
6 Business-Analyse in weiteren Kontexten
6.1 Einleitung
6.2 Organisatorische Einbettung von Business-Analysten
6.3 Business-Analysten im Projektmanagement
6.3.1 Abgrenzung der Rollen Projektleiter und Business-Analyst
6.3.2 Business-Analyse vor Projektstart und nach Projektende
6.3.3 Projektleiter und Business-Analyst in Personalunion
6.4 Business-Analysten im Prozessmanagement
6.4.1 Überblick zu Prozessmanagement
6.4.2 Überblick zu Business-Analyse
6.4.3 Prozessmanagement und Business-Analyse im Vergleich
6.5 Positionierung von Business-Analysten
6.5.1 ibo-Positionierungswürfel
6.5.2 Business-Analyst-Canvas
Literatur zu Kapitel 6
Anhang: Personenzertifizierungen
Glossar
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
G Grundlagen
G.1 Existenzberechtigung der Business-Analyse
G.1.1 Berufsbild Business-Analyse
Das Berufsbild der Business-Analyse hat sich in den letzten Jahren zunehmend etabliert. Immer häufiger werden Business-Analysten in unterschiedlichen Unternehmen und Branchen eingesetzt. Allerdings ist dieses Aufgabenfeld noch nicht so bekannt, standardisiert und etabliert wie zum Beispiel Projektmanagement oder Prozessmanagement.
Читать дальше