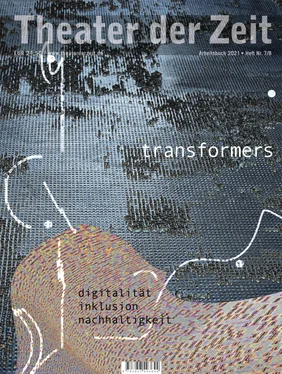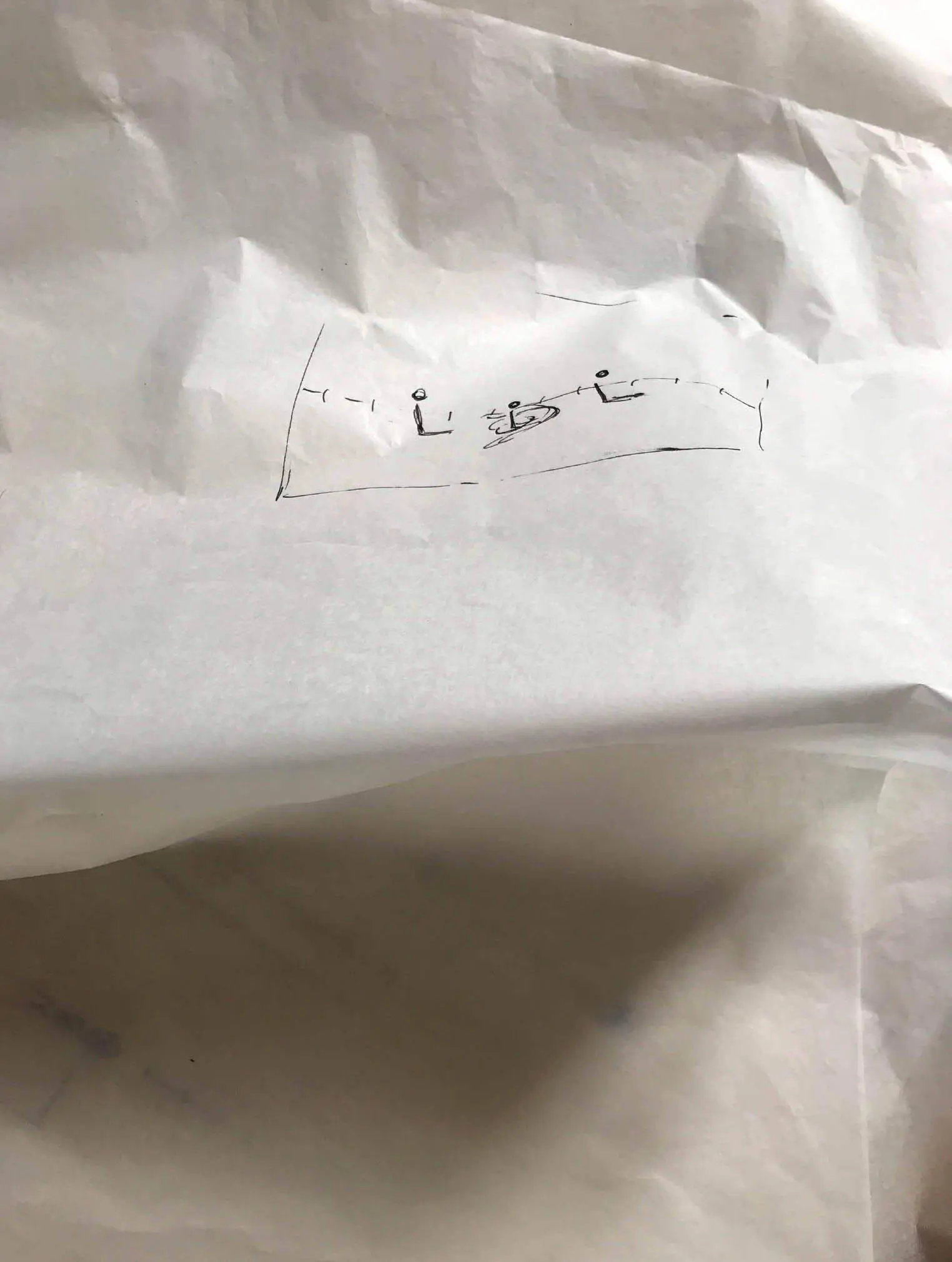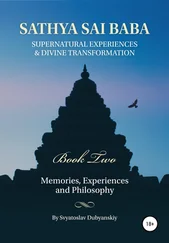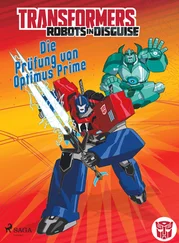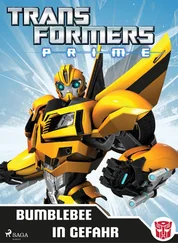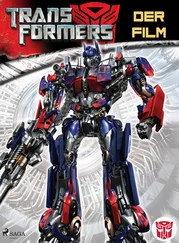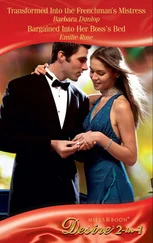Inklusion
gegen die tür
theater, inklusion und architektur – eine bestandsaufnahme JULIANE ZELLNER
Inklusion
die katze der inklusion
gespräch zwischen AMELIE DEUFLHARD und JONAS ZIPF
Inklusion
digitale erschließungen
eine utopie der zugänge, digitalität, diversität und theater MIRIAM MICHEL
Digitalität / Inklusion
krumme rücken oder offene augen
über plattformkapitalismus und inklusion. JONAS ZIPF im gespräch mit JOSEPH VOGL
Digitalität / Inklusion
parasiten
MARC SINAN
von heute auf morgen
was bedeutet diversität und wie setzen wir sie im theater um? JULIANE ZELLNER im gespräch mit LISA SCHEIBNER und KATE BREHME
Inklusion
ich, ein*e transformer*in
NENAD ČUPIĆ
Inklusion / Nachhaltigkeit
beyond digital
über (post-)digitale bühnen BIRGIT WIENS
Digitalität
oper, klima und der wandel
„Wechsel/Wirkung“ BERTHOLD SCHNEIDER, UWE SCHNEIDEWIND, CAROLINE BAEDECKER UND MANFRED FISCHEDICK
Nachhaltigkeit
von der pflicht zur kür
nachhaltigkeitsmanagement an der oper göteborg ANNETT BAUMAST
Nachhaltigkeit
empathische feedbackschleifen
für ein postdigitales theater von Judith Ackermann und Benjamin Egger
Digitalität
über transformation und das muffeln
JULIANE ZELLNER im gespräch mit HORTENSIA VÖLCKERS
Nachhaltigkeit / Digitalität / Inklusion
digitaler humus
BETTINA MILZ
Digitalität
la forza del destino
oder: die vernetzung der theaterlandschaft MARCUS LOBBES
Digitalität
für einen fonds ästhetik und nachhaltigkeit | FÄN
raus aus den echokammern – aufruf zur kompliz:innenschaft! ADRIENNE GOEHLER und MANUEL RIVERA und 107 Stimmen aus Kunst, Wissenschaft und dem Dazwischen
Nachhaltigkeit
eskalation und enttäuschung
transformation zwischen bottom up und top down JONAS ZIPF im gespräch mit RAHEL JAEGGI und CARSTEN BROSDA
Digitalität Nachhaltigkeit Inklusion
indikatorische notationen
MICHAELA ROTSCH
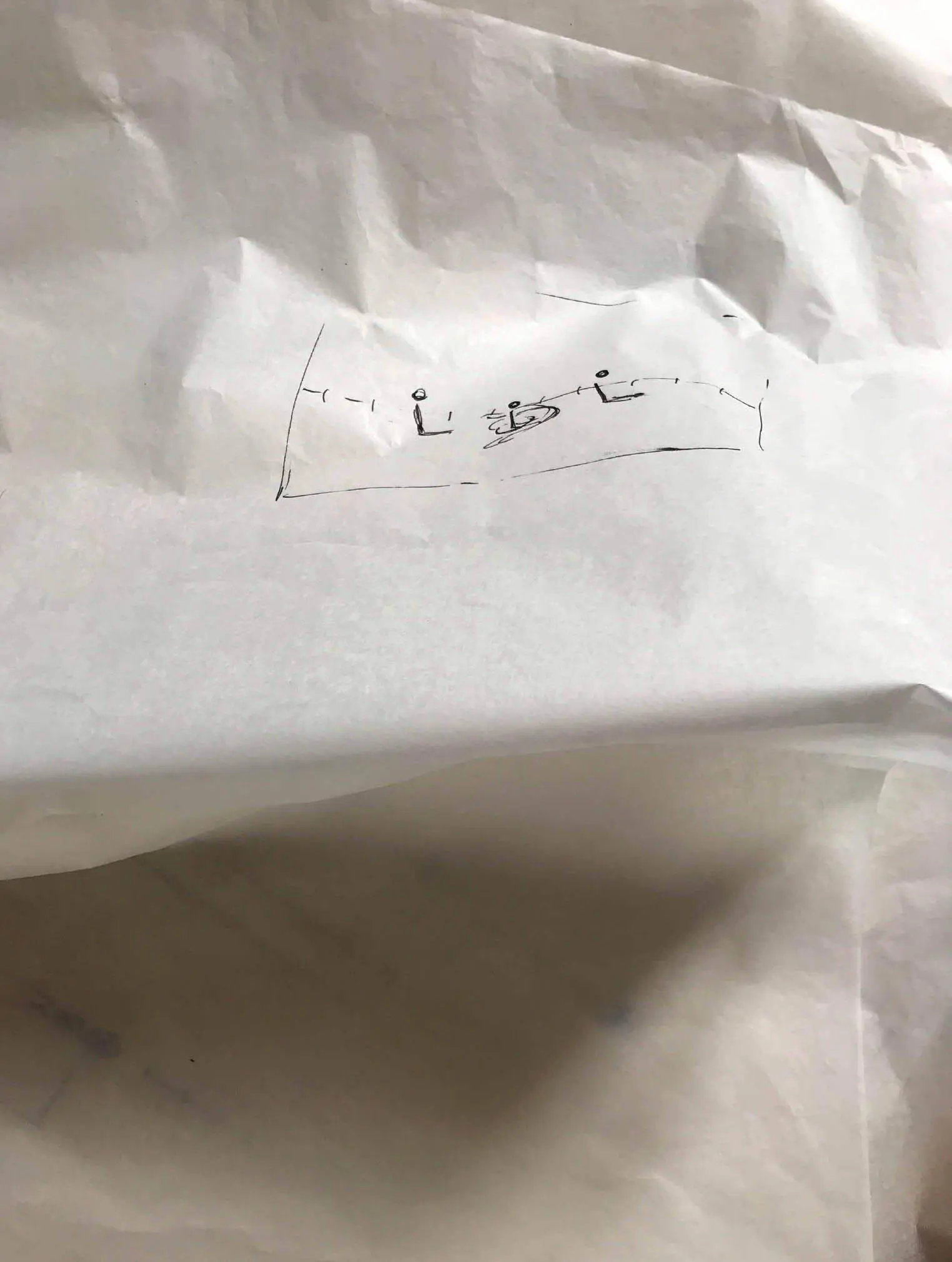
NOTATION_SFBODIES 00‘39~
INDIKATORISCHE NOTATIONEN von Michaela Rotsch
zu STRANGE FOREIGN BODIES von Zufit Simon
design und desaster
vorrede zur transformation des theaters
Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Inklusion – die Themen der Großen Transformation unserer Zeit waren alle schon vor Corona da. Die Pandemie katalysiert und beschleunigt ihre Effekte. Ein oft gebrauchtes Bild, deswegen nicht weniger wahr: Corona zeigt uns im Brennglas, was los ist. Kein Zufall, dass wir gerade jetzt verstärkt über Rassismus und die Fleischindustrie sprechen, über Klassismus und Bildung, über das Anthropozän oder die Veränderung unserer Innenstädte. Doch was ist das überhaupt, diese ominöse Transformation, von der auf einmal alle reden? Und was bedeutet sie für den Theaterbetrieb?
Zum Einstieg in das Arbeitsbuch befragt JONAS ZIPF die Soziologin SILKE VAN DYK und den Architekten FRIEDRICH VON BORRIES. Ein Gespräch über Begriffe und ihren Gegenstand, über Form und Inhalt, über das Erzählen und Erleben und darüber, ob sich die ganze Sache mit dem Theater noch irgendwie verändern lässt.
JONAS ZIPF: Unser Gespräch setzt den Einstieg und Rahmen für ein Arbeitsbuch zur Transformation des Theaterbetriebs. Es steht unter dem Titel Transformers und widmet sich drei thematischen Schwerpunkten, mit denen wir Herausgeber*innen die Transformationsthemen, die das Theater und den Kulturbetrieb betreffen, clustern. Die drei Schlagwörter lauten Nachhaltigkeit, Inklusion – wir sprechen bewusst von Inklusion und nicht von Diversität – und Digitalisierung. In unserem Buch versammeln wir Texte und Thesen, Ansätze und Ausblicke, skizzieren Prozessdesigns der Transformation. Als Pendant zu unserem heutigen Gespräch steht am Ende des Buchs der gedankliche Austausch zwischen Rahel Jaeggi und Carsten Brosda. Da wollen wir darüber sprechen, wie das gehen soll: die große Veränderung und der Alltag der Theater- und Kulturbetriebe. Top down oder Bottom up? Mit euch möchte ich in dieses Buch einsteigen: Was ist das eigentlich, die Große Transformation, die gerade in aller Munde ist und so unendlich unterschiedlich aufgeladen wird. Wie ereignet sie sich? Wen betrifft sie? Und wen erreicht sie? Aber zunächst zum Transformationsbegriff selbst: Worin unterscheidet sich Transformation von Reform?
FRIEDRICH VON BORRIES: Ich sehe da zwei Ansätze. Einerseits trägt die Reform das „Re“ in sich, also eine Vorstellung davon, dass es mal eine Form gegeben hätte, die es wieder herzustellen gälte. Andererseits sehe ich diesen Begriff stark im politischen Raum verortet, der häufig noch von der Vorstellung geprägt ist, dass Politik ein prägender gesellschaftlicher Treiber sei, während wir bei den gegenwärtigen gesellschaftlichen Veränderungsprozessen andere Akteure erleben: Akteure aus Kunst und Kultur, aus der Zivilgesellschaft, aber auch aus der Wirtschaft. Ich verstehe Transformationsprozesse also so, dass es nicht mehr das Primat der Politik gibt, sondern – und darin besteht ja vielleicht auch ein Problem der Gegenwart – das Feld der Politik der Wirklichkeit hinterherhinkt, weil viele gesellschaftliche Bereiche sich bereits transformiert haben. Ich sehe den Unterschied zwischen den beiden Begriffen also darin, dass Reformen etwas beschreiben, was es schon gegeben hat und wieder herzustellen gäbe, also Re-Formieren, Transformationen dagegen von anderen, neuen Akteurskonstellationen ausgehen. In dieser Veränderung der Akteurskonstellationen zeigt sich dann auch noch ein dritter Aspekt: Denn ich glaube, dass die Transformation ein Verwandlungsprozess ist, in dem das ursprüngliche Wesen erhalten bleibt, sich zwar die Form verändert, aber das, was darin liegt, dennoch als Energie erhalten bleibt – nur eben transformiert. Anders als eine Revolution, die alles umkehrt und grundlegend verändert, ist die Transformation ein langsamer Prozess.
JONAS ZIPF: In deinem Buch Weltentwerfen entwickelst du allerdings eine „politische Designtheorie“ und beschreibst gesellschaftliche Veränderung als Gestaltungsanspruch an die kleinen und die großen Dinge. Um zunächst beim Abgrenzen der Begriffe zu bleiben: Würdest du dich als Transformationsdesigner bezeichnen?
FRIEDRICH VON BORRIES:Mir gefällt an solchen Begriffen nicht, dass sie den gerade im akademischen Raum ständig wiederkehrenden, stark konkurrenzorientierten Versuch darstellen, Alleinstellungsmerkmale zu schaffen. Oft geht es dabei um akademische Selbstbehauptung oder -vermarktung. Was ich aber an dem Begriff mag, ist, dass eine Gestaltungsdimension nach vorne geschoben wird, also dass der Begriff einen Gestaltungsvorgang beschreibt – also dass Transformation nicht unwillkürlich über uns hinwegrollt, sondern gestaltbar ist, ein Prozess, an dem übrigens viele Menschen beteiligt sind, ob sie wollen oder nicht. Aus der Praxis eines Architekten heraus gesprochen fällt mir negativ auf, dass in den Transformations- und Nachhaltigkeitsdiskursen der Gegenwart diejenigen, die sich mit der Gestaltung von Veränderungen aktiv auskennen – also Architekt*innen, Designer*innen oder Künstler*innen – überhaupt nicht vorkommen. Im Rat für Nachhaltigkeit sitzen Sozialwissenschaftler*innen, die das alles beschreiben können; da sitzen Technikwissenschaftler*innen oder Ingenieur*innen, die alles technisch neu erfinden wollen – aber die, die genau die Zwischenschritte zwischen technischen Möglichkeiten und gesellschaftlichen Machbarkeiten machen, diejenigen, die mit diesen Möglichkeiten kreativ und gestalterisch, im wahrsten Sinne des Wortes, umgehen, die fehlen. Es ist mir also wichtig, daran zu erinnern, dass man die auch braucht: Ihr seht: Letztlich verstehe ich Begriffe wie Transformation und Transformationsdesign in ihrer praktischen Dimension. Zur theoretischen Begriffsdefinition würde ich lieber an die Sozialwissenschaftlerin in der Runde weitergeben.
Читать дальше