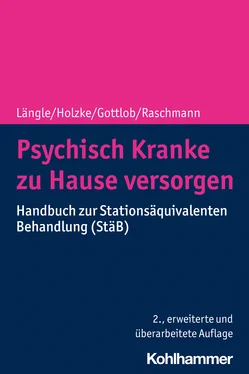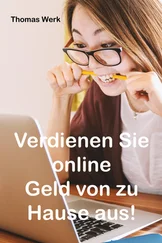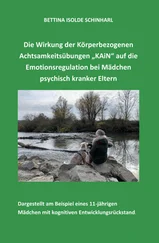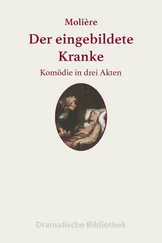Die DGPPN hat im Juni 2017 gemeinsam mit BDK, ackpa, LIPPs, DGGPP, BFLK und DFPP ein erstes Positionspapier zur Leistungsbeschreibung herausgegeben. Eine Arbeitsgruppe der Fachgesellschaften und Klinikverbände hat gemeinsam mit den Leistungserbringern aus dem ambulanten Bereich Empfehlungen erarbeitet, wie die Kooperation der Kliniken mit den ambulanten Leistungserbringern bei der stationsäquivalenten Behandlung umgesetzt werden kann. Dieses wurde im Mai 2018 veröffentlicht ( 
Anhang 1
).
Vor dem Hintergrund der großen Chance, die StäB für die Verbesserung der Versorgung psychisch erkrankter Menschen bringen kann, und der gleichzeitigen Verunsicherung der Leistungserbringer ist das Handbuch zur stationsäquivalenten Behandlung eine hervorragende Initiative, ein kompaktes Nachschlagewerk mit sehr konkreten Anleitungen zur Umsetzung.
Den Autor*innen und Herausgeber*innen gilt Dank, dass sie die vielen Fragen, die in den motivierten Kliniken, die alsbald StäB umsetzen wollen, immer wieder gestellt werden, mit ihren internationalen und nationalen Erfahrungen anschaulich beantworten.
Gesetzliche Grundlagen, Vereinbarung der Selbstverwaltung, Beschreibung der Zielgruppe und vor allem eine sehr konkrete Anleitung zur Umsetzung, machen dieses Handbuch zu einem Grundlagenwerk stationsäquivalenter Behandlung. Die eigenen jahrelangen Erfahrungen aus den Zentren für Psychiatrie Südwürttemberg machen beim Lesen Mut, in den eigenen Kliniken das Projekt stationsäquivalente Behandlung umzusetzen.
Allen Autor*innen und Herausgeber*innen sei für diese Initiative gedankt, verbunden mit dem Wunsch, dass die Leser des Handbuchs motiviert werden, die Chance, die der Gesetzgeber uns mit den stationsäquivalenten Leistungen eröffnet hat, zeitnah umzusetzen, um die Versorgung für Menschen mit psychischen Erkrankungen um eine wesentliche Behandlungsform im häuslichen Umfeld zu ergänzen.
Dr. med. Iris Hauth
Geschäftsführerin und Ärztliche Direktorin der Alexianer St. Josephs Krankenhaus Berlin-Weißensee GmbH; als Past President Mitglied des Vorstandes der DGPPN
Liebe Leserinnen,
im Jahr 2018 wurde die 1. Auflage dieses Handbuchs erarbeitet und veröffentlicht. Damals war die stationsäquivalente Behandlung (StäB) in Deutschland noch weitgehend Neuland. Wir hatten aus den Modellprojekten einige Vorerfahrung gesammelt und gründeten darauf basierend unsere Konzepte. Aber erst wenige Monate später konnten wir auch konkrete Umsetzungserfahrung vorweisen. StäB wurde von vielen noch als ein sehr zartes Pflänzchen mit ungewisser Zukunft betrachtet.
Mittlerweile sind knapp drei Jahre vergangen und es ist, darin waren sich Autoren und Verlag einig, dringend notwendig, eine 2., stark überarbeitete Auflage herauszugeben. Denn wir wollen mit diesem Handbuch am Puls der Zeit sein, Sie mit den aktuellen Entwicklungen vertraut machen und der Umsetzung von StäB in Deutschland weiterhin neue Impulse geben.
In unseren Einrichtungen in Südwürttemberg können wir mittlerweile auf weit über 1.500 Behandlungen in dieser neuen aufsuchenden Form der Akutbehandlung zu Hause zurückschauen. Wir verfügen über persönliche Erfahrungen, über Zahlen und Fakten und auch über wissenschaftlich erhobene Rückmeldungen unserer Patientinnen. Aus dem Pflänzchen ist ein Baum mit tragfähigem Stamm und stabilen Ästen geworden.
Auf Bundesebene hat sich die anfangs kleine Interessengruppe StäB etabliert und führt als Facharbeitsgruppe der DGPPN eine lebhafte Diskussion um die beste Umsetzung von StäB und tauscht Erfahrungen und Konzepte aus.
Im Rahmen des Innovationsfonds des GBA wird die sogenannte AKtiV-Studie als multizentrische Studie zur umfassenden Erforschung der Implementierung und der Wirksamkeit von StäB durchgeführt. Studienbeginn war im Sommer 2020, erste Ergebnisse werden 2022 vorliegen (Baumgardt et al. 2020, 2021). Auch in den wissenschaftlichen Fachzeitschriften wurde StäB durch eine Reihe von Veröffentlichungen in den letzten beiden Jahren viel Aufmerksamkeit gewidmet. Die neueste Literatur ist in den Verweisen zu den einzelnen Kapiteln entsprechend eingearbeitet.
Manche Bundesländer haben sich in ihrer Landeskrankenhausplanung mit StäB befasst und in dem einen oder anderen Bundesland wurden klare und verlässliche Strukturen zur planerischen Umsetzung von StäB geschaffen.
Parallel zu diesen Entwicklungen wurde die neue Behandlungsform schon in ihren ersten beiden Umsetzungsjahren einem maximalen Stresstest ausgesetzt: Die Corona-Pandemie war auch für die Einführung und Entwicklung von StäB eine Herausforderung. Zum einen hatten die Kliniken plötzlich ganz andere und grundsätzliche Probleme und Sorgen, zum anderen war die Frage zu beantworten, ob StäB unter Corona-Bedingungen möglich – oder vielleicht sogar geboten – ist.
Da sich all dies in den vergangenen drei Jahren entwickelt und ergeben hat, haben wir uns zu dieser 2. Auflage entschlossen.
Wir wollen weiterhin ein überschaubares, handhabbares und leicht zu lesendes Handbuch vorlegen. Aus diesem Grund haben wir an Stellen, wo neue Kapitel notwendig waren, alte Kapitel gestrichen oder ersetzt. Strategien und Konzepte wichen der Beschreibung von Umsetzungserfahrungen und bewährten Prozessen. Die o. g. neuen Themen wurden als eigene Kapitel aufgenommen. Gestärkt wurde auch der uns sehr wichtige Blickwinkel der Betroffenen, einerseits durch entsprechende Statements von Vertretern entsprechender Organisationen, andererseits durch die Darstellung von neuesten Forschungsergebnissen.
Wir hoffen, dass wir auch mit dieser Auflage Ihr Interesse getroffen haben und dass wir mit Ihnen gemeinsam der stationsäquivalenten Behandlung zu einer weiteren Verbreitung helfen können. Wir sind überzeugt, dass dies für unsere Patientinnen von hoher Bedeutung ist. Zudem haben wir die Erfahrung gemacht, dass der Arbeitsplatz psychiatrisches Krankenhaus durch StäB eine neue Attraktivität gewinnt.
Im Folgenden wird zur Bezeichnung gemischtgeschlechtlicher Personen und Gruppen aus Gründen der Lesbarkeit abwechselnd pro Sinnabschnitt die männliche und weibliche Form verwendet. Gemeint sind stets alle Geschlechter.
Südwürttemberg, im Herbst 2021
Die Autorinnen
Baumgardt J, Schwarz J, Bechdolf A et al. (2021) Implementation, efficacy, costs and processes of inpatient equivalent home-treatment in German mental health care (AKtiV): protocol of a mixed-method, participatory, quasi-experimental trial. BMC Psychiatry 21(1): 173.
Baumgardt J, Schwarz J, von Peter S et al. (2020) Aufsuchende Krisenbehandlung mit teambasierter und integrierter Versorgung (AKtiV). Nervenheilkunde 39(11): 739–745.
Dr. phil. Johanna Baumgardt: Sozialwissenschaftlerin (M. A.), Wissenschaftlerin und Forschungskoordinatorin an den Kliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik mit Vivantes Klinikum Am Urban und Vivantes Klinikum im Friedrichshain, Akademische Lehrkrankenhäuser Charité – Universitätsmedizin Berlin, wissenschaftliche Mitarbeiterin der AG Sozialpsychiatrische & partizipative Forschung am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Prof. Dr. med. Andreas Bechdolf: M. Sc. Gesundheitsökonomie und Krankenhausmanagement, Psychiater und Psychotherapeut. Chefarzt an den Kliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik mit Vivantes Klinikum am Urban und Vivantes Klinikum im Friedrichshain, Akademische Lehrkrankenhäuser Charité – Universitätsmedizin Berlin.
Prof. Dr. med. Isabel Böge: Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie. Chefärztin der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters, ZfP Südwürttemberg.
Читать дальше