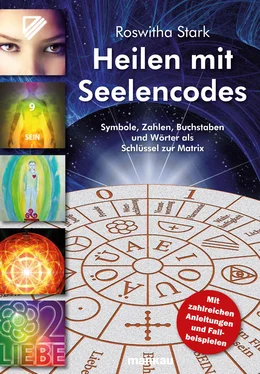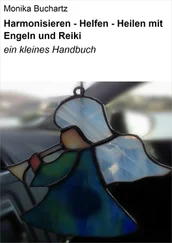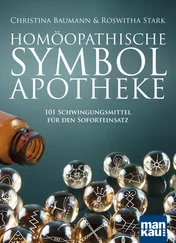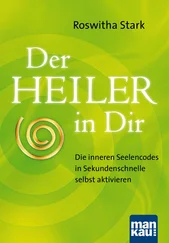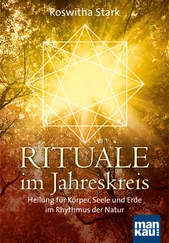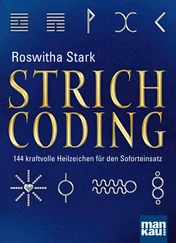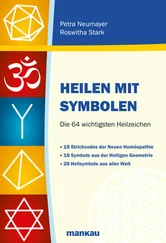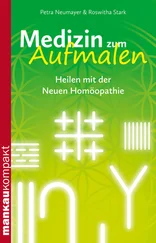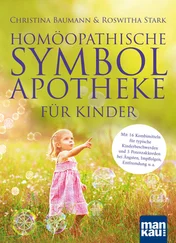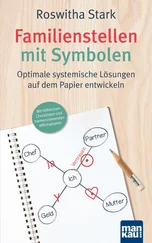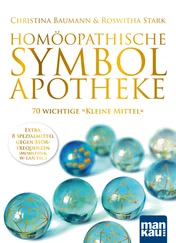Delfine: Verständigen sie sich über Telepathie?
Der englische Forscher und Biologe Rupert Sheldrake beschreibt dieses Gebaren sehr schön in seinem Buch „Der siebte Sinn der Tiere“. Über für uns Menschen nicht sichtbare (wohl aber nutzbare!) morphogenetische Felder ist eine Art telepathische Kommunikation möglich. Tiere zeigen uns sehr deutlich, dass sie unsere Gedanken auch über größere Entfernungen hinweg wahrnehmen können. Und sie verhalten sich auch entsprechend.
Im Jahr 2010 beobachtete ich bei einer Bootstour in Island eine Gruppe von sieben Delfinen. In einer wunderbar synchronen Formation schwammen und sprangen sie neben dem Boot her. Und machten immer wieder plötzliche Kehrtwendungen um 90 oder 180 Grad, alle synchron, so als hätte ein unsichtbarer Kommandeur allen gleichzeitig den Befehl gegeben. Was für ein Kuddelmuddel hätte das wohl bei menschlichen Schwimmern ergeben? Es war wunderschön, dieser pfeilschnellen Abstimmung und Synchronisation über das unsichtbare Feld zuzusehen.
Personen, die Tierkommunikation erlernen, wissen, dass auch wir Menschen einen solchen „siebten Sinn“ haben und dass wir das elektromagnetische Feld telepathisch nutzen können – die australischen Aborigines und andere Naturvölker tun dies im Übrigen noch heute selbstverständlich, soweit sie nicht inzwischen „zivilisiert“ sind. Die „Errungenschaften“ der Zivilisation mit ihren zahllosen (Stör-) Frequenzen haben uns weit entfernt vom alten Wissen um unsere „unsichtbaren“ Kommunikationsmöglichkeiten. Spirituelle Bewegungen und quantenphysikalische Forschungsergebnisse fördern aber den Wiederzugang der Menschen zu ihrem ganzen Wahrnehmungspotenzial. Und das ist gut so. Es ist ein Geschenk, all unsere Sinne wiederzuentdecken und zu einer sehr viel feineren und „sinnlicheren“ Kommunikation zurückzufinden. Fahren wir also unsere Antennen wieder aus!
Lange Zeit konnten wir uns nicht vorstellen, dass sogar Pflanzen „sprechen“ können. Schließlich besitzen Sie keinen Mund, keine Ohren, keine Stimme. Und wir glauben ja meist nur das, was wir „wahrnehmen“ können, also mit unseren (beschränkten) Sinnen bemerken. Auch „stummen“ Tieren trauen wir kein allzu großes kommunikatives Bewusstsein zu, aber die können sich wenigstens noch bewegen, während Pflanzen nicht einmal dazu imstande sind. Wie sollten sie sich also untereinander austauschen? Wie mit Tieren? Und wie auch noch mit uns Menschen?

Als eine Waldrebe im Garten meiner Mutter vier Jahre lang keine Anstalten machte, auch nur eine einzige Blüte hervorzubringen, stellte sich meine Mutter vor sie hin und sagte: „Schade, dass du nicht blühen magst, muss ich dich wohl hier wegtun …“ Kurze Zeit später blühte die Pflanze erstmals in ihrer ganzen Pracht und seither jedes Jahr unermüdlich. Zufall?
Auch wenn wir es nicht so leicht wahrnehmen können: Pflanzen müssen kommunizieren, sonst könnten sie nicht überleben. Sie müssen sich ernähren, fortpflanzen, vor Angreifern in Form von hungrigen Tieren und Insekten schützen. Dazu haben sie ein erstaunliches Arsenal an Mitteilungsmöglichkeiten und äußerst kreativen Botschaften entwickelt:
Eine schier unglaubliche Vielfalt an Formen, Farben und Duftstoffen lockt Insekten zur Bestäubung an. Schädlinge dagegen werden energisch mit für sie unangenehmen Stoffen abgehalten – über raue ungenießbare Brennhaare, Stacheln oder das Einlagern von Kieselsäure, Phytohormone und andere Substanzen. Das funktioniert allerdings nur, solange die Schädlinge nicht in der Überzahl sind. Auch ätherische Öle wie im Thymian, Lavendel oder Rosmarin mögen die meisten Fressfeinde nicht, was sich auch die Menschen für die Herstellung von Antimückenmitteln zunutze machen.

Die Sprache der Pflanzen birgt für uns Menschen noch viele Geheimnisse.
Vor rund 20 Jahren starteten Wissenschaftler Forschungen, die über die optisch-chemische Kommunikationsthese hinausgehen sollten. Sie wollten herausfinden, inwieweit schädlingsbefallene Pflanzen ihre Nachbarn „warnen“ können. Maispflanzen alarmieren zum Beispiel nützliche Schlupfwespen, wenn sie von Schmetterlingsraupen befallen werden. Und Akazienbäume in Afrika halten durch die Bildung von Bitterstoffen Elefanten und Giraffen davon ab, den Baum kahl zu fressen.
Die Forscher nahmen an, diese Art der Verständigung zwischen befallenen Pflanzen und ihren (noch) nicht geschädigten Artgenossen müsste wohl mittels flüchtiger organischer Substanzen geschehen. Diese Substanzen nannten sie „VOCs“, abgekürzt aus dem englischen „volatile organic compounds“. Die Mehrzahl der Forschergruppen untersuchte daraufhin die Kommunikation zwischen Pflanzen vor allem über VOCs und verlor dabei etwaige andere Möglichkeiten wie eine synchrone Verständigung über das morphogenetische Feld aus den Augen (siehe das Beispiel der Delfine).
Die Sprache der Pflanzen birgt noch viele Geheimnisse. Dabei haben wir auch in der Kommunikation mit diesen Lebewesen viel des alten Wissens verloren und vergessen. Aber wir können die Sprache der Pflanzen mit Herz und Gefühl und in einer stillen meditativen Haltung wieder entschlüsseln lernen, und wir dürfen sie für uns und unsere Gesundheit nutzbar machen. Und dann hören wir wieder das Flüstern, das Rauschen und Tuscheln, das Raunen und die magischen Worte in Wald und Flur – und genießen diesen Dialog mit allen Sinnen!
Signaturenlehre
„Denn durch die Kunst der Chiromantie, Physiognomie und Magie ist es möglich, gleich von Stund an nach dem äußeren Ansehen eines jeden Krautes und einer jeden Wurzel Eigenschaft und Tugend zu erkennen, an deren Zeichen (Signatis), Gestalt, Form und Farbe …“
Paracelsus
Neben der rein wissenschaftlichen, eher stofflichen Herangehensweise an das Wesen und den Ausdruck der Pflanzen gibt es aber noch einen anderen, viel älteren Weg der Heilpflanzenerkenntnis, die sogenannte Signaturenlehre. Das lateinische Wort „signum“ heißt Zeichen, Gestalt, Form oder Merkmal (im englischen „sign“ oder im spanischen „el signo“ finden wir die Bezeichnung zum Beispiel wieder). Anhand der äußeren Merkmale einer Pflanze versuchten die Menschen vermutlich schon sehr früh herauszufinden, ob eine Pflanze essbar wäre oder etwa für ein bestimmtes gesundheitliches Thema förderlich sein könnte. Ähnlich wie die Fährtensucher wollten die Menschen die Botschaft der Pflanze „übersetzen“, um sie sich zunutze zu machen. Daraus entwickelte sich letztendlich auch die heutige Kräuterheilkunde, die viel mehr traditionelles überliefertes Wissen beinhaltet als eine rein auf chemischen Einzelbestandteilen fußende wissenschaftliche Herangehensweise.
Aber erst durch die schriftlichen Niederlegungen der beiden großen „Naturärzte“ und Alchemisten Paracelsus (1493 – 1541) und Giambattista della Porta (1538 – 1615) fand die Signaturenlehre eine weite Verbreitung und Beachtung und wurde zu einem wesentlichen Teil der anthroposophischen Medizin.
Diese Arzneilehre schließt von der äußeren Erscheinung einer Pflanze, zum Beispiel von Farbe und Form, auf das innere Wesen und deren Wirkung. So verglich man zum Beispiel die Form der Blätter mit einem Organ; da Lungenkraut wie eine Lunge aussieht, musste es wohl eine Heilpflanze für die Lunge sein. Da eine Brennnessel brennt, musste sie wohl zur Behandlung „brennender“ Erkrankungen wie etwa der Nesselsucht geeignet sein; da eine rosafarbene Rose eine liebliche Blattform und eine zarte Farbe hat, musste sie wohl geeignet sein, die Liebe zu fördern. Und auch für körperliche Herzprobleme wurde sie gerne verwendet. Neben der Interpretation und dem Rückschluss von äußeren Merkmalen und dem Standort der Pflanze auf deren Nützlichkeit ist die Signaturenlehre aber noch viel mehr: Sie ist ein umfangreiches Zuordnungssystem, das auf der Erkenntnis des philosophisch-kosmischen Denkens basiert: Mikrokosmos ist gleich Makrokosmos – wie innen, so außen – wie oben, so unten. Und so ist die Lehre von den Zeichen in der Natur auch eine umfangreiche Entsprechungs- und Analogielehre, die die Pflanze zum Beispiel den Elementen Wasser, Erde, Luft und Feuer oder den Planeten zuordnet.
Читать дальше