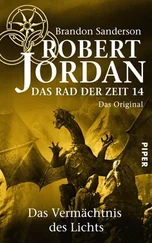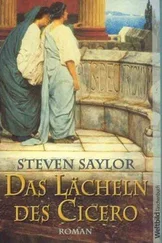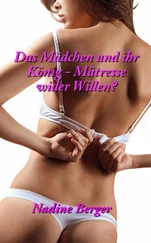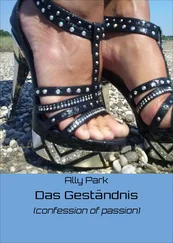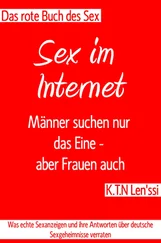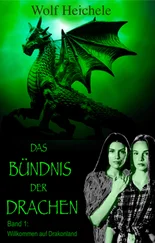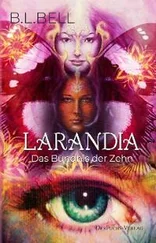In der Forschung gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, woher die Sprache nach Heraklit ihre Legitimation erhält. Es wurde versucht, ihn einer Position im φύσει-θέσει/νόμῳ-Streit eindeutig zuzuordnen. Demnach beruht die Richtigkeit der Namen einmal auf einer natürlichen Zuordnung von Wort und Sache (φύσει), einmal auf einer vom Menschen gesetzten (θέσει). Lersch17, Di Cesare18 und Leiss19 vertreten die Ansicht, dass die heraklitischen Fragmente mit der φύσει-These einhergehen. Grund für diese Annahme liefert auch der Kratylosdialog Platons, in welchem Kratylos, ein Schüler Heraklits, die These von der natürlichen Sprachentstehung vertritt.20 Heraklit kann aber keiner der beiden Positionen explizit zugeordnet werden,21 weil er die Differenzierung, ob die Richtigkeit von Namen als φύσει oder θέσει zu bestimmen ist, noch nicht in der Form im Blick hat, wie sie sich im weiteren Verlauf des sprachphilosophischen Denkens entwickelt.22
Als Gegenspieler zu Heraklit wird häufig Parmenides (ca. 540–470 v. Chr.) genannt.23 Dies ist vor allem der Fall, wenn man Heraklit der φύσει-Theorie zuordnet. Beide Denker weisen jedoch mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede auf und sind fest im Denken der archaischen Logik verwurzelt. Parmenides nimmt einen untrennbaren Zusammenhang von Denken, Sprechen und Sein an, wonach das Nichtseiende weder gedacht noch gesagt werden kann, „οὔτε γὰρ ἂν γνοίης τό γε μὴ ἐὸν – οὐ γὰρ ἀνυστόν – οὔτε φράσαις“24 (denn weder erkennen könntest du das Nichtseiende – das ist ja unausführbar – noch aussprechen). Er ist der erste, der das Sein mit einem Namen versieht und es als τὸ ὄν bezeichnet.25 Das τὸ ὄν ist der Ort des Denkens. Im Denken ist das Sein bereits ‚als Gesagtes’ vorhanden: „οὐ γὰρ ἄνευ τοῦ ἐόντος, ἐν ὧι πεφατισμένον ἐστιν, εὑρήσεις τὸ νοεῖν“26 (denn nicht ohne das Seiende, in dem es als Ausgesprochenes ist, kannst du das Denken antreffen). Das Gesagte impliziert für Parmenides Wirklichkeit, weil er eine Wesenszusammengehörigkeit von Denken und Wahrheit annimmt, auf die sich der Mensch einlässt, wenn er spricht.27 Für Parmenides besteht in der Tradition des archaischen Denkens ein unanzweifelbarer Zusammenhang zwischen Wort und Sache.28 Dieser entsteht durch Übereinkunft;29 dennoch versteht Parmenides die Namen nicht als willkürliche Setzung; die Namen stammen zwar vom Menschen, sind aber dennoch keine „revidierbare Konvention, wohl aber etwas, was überhaupt zu Lasten des Menschen geht, im Unterschied zu dem, was jeglichem menschlichen Tun vorgegeben ist“30. Auch hier tritt die Unterscheidung zwischen φύσει und θέσει nicht derart deutlich hervor, wie dies in der Folgezeit der Fall ist. Es kann für Parmenides kein Gegensatz zwischen den beiden Theorien ausgemacht werden, da er die Theorie, dass die richtige Zuordnung von Wort und Sache aus einem natürlichen Zusammenhang resultiert, nicht einmal aufgreift.31
Dem engen Zusammenhang von Name und Sache steht der Doxa-Teil des parmenidischen Lehrgedichts gegenüber.32 Der philosophischen Erkenntnis der Wahrheit sind auch bei Parmenides die Meinungen entgegengesetzt.33 Er warnt, ebenso wie Heraklit, davor, sich von den gesprochenen Worten täuschen zu lassen. Da die Namen auf einer Festsetzung beruhen, kommt in ihnen δόξα zum Tragen. In der δόξα ist das Werden manifestiert, dem Parmenides einen großen Stellenwert beimisst. Alle Sterblichen nehmen dieses Werden wahr, beispielsweise wenn der Tag zur Nacht wird. Der Mensch aber macht einen Fehler bei der Benennung von Phänomenen des Werdens: Er hätte nicht zwischen Tag und Nacht unterscheiden und zwei Namen ausmachen dürfen, sondern nur einen, weil es sich um das eine, um τὸ ὄν, handelt. Die Menschen haben aber nicht Sein und Nichtsein – welches sowieso unmöglich zu denken und zu sprechen ist34 – unterschieden, sondern zwischen Licht und Nacht, deshalb entsteht δόξα, während sich in der ἀλήθεια die tatsächliche Unterscheidung zwischen Sein (ὄν) und Nichtsein (μὴ ἐόν) widerspiegelt.35 Indem also der Einheit des Seins als dem Objekt der Erkenntnis eine Vielfalt von Namen entgegenstellt wird, entsteht δόξα36.
Heraklit und Parmenides thematisieren Sprache als Wort, d.h. die eben behandelte Frage nach dem Verhältnis von Wort und Gegenstand. Die Beziehung zwischen einzelnen Wörtern als Satz ist dagegen noch nicht Gegenstand des archaischen Denkens.37 Hauptsächlich thematisieren Heraklit und Parmenides jedoch Sprache im Allgemeinen , d.h. „als eine Form des Universums, die dieselbe Struktur wie die übrigen Formen des Universums (…) aufweist (…) oder nicht aufweist“38. Ein Bewusstsein für diese unterschiedlichen Fragestellungen tritt erst in platonischer Zeit ein.39
Zusammenfassung:
Im Mittelpunkt der Sprachphilosophie von Heraklit und Parmenides steht der λόγος-Begriff. Der von Heraklit und Parmenides angenommene Zusammenhang von Wirklichkeit/Sein, Denken und Sprache bestimmt die weiteren sprachphilosophischen Überlegungen. Er durchbricht das magisch-mythische Einheitsdenken von Wort und Sache, indem durch die Einführung des λόγος-Begriffs Sprache mit Denken und Vernunft verbunden und in Bezug zueinander gesetzt wird. Zwischen Sprache und Wirklichkeit besteht für diese Philosophen ein unmittelbarer Zusammenhang. So ergibt sich für Heraklit und Parmenides zwar keine Einheit von Name und Sache, aber ein unmittelbarer Bezug beider Komponenten. Allerdings weist Heraklit bereits darauf hin, dass der Bezug von Name und Objekt auseinanderfallen kann; auch Parmenides weist auf trügerische Namen hin, die nicht die Einheit des Seins wiedergeben. Ob die Sprache ihre Begründung φύσει oder θέσει erhält, lässt sich bei Heraklit nicht abschließend klären, für Parmenides ist letzteres anzunehmen. Insgesamt werden bei Heraklit und Parmenides sprachphilosophische Überlegungen angestoßen, die im weiteren Verlauf der Philosophiegeschichte eine wichtige Rolle spielen und ausführlich diskutiert werden.
Es ist fraglich, ob bei Platon (428/427–348/347 v. Chr.) bereits von Sprachphilosophie als einer eigenen philosophischen Disziplin gesprochen werden kann. Sprache ist aber ein wichtiges Thema in den Dialogen Platons: Der platonische Sokrates und dessen Dialogpartner diskutieren über den Ursprung, die Funktion und die Legitimation von Sprache sowie über das Wesen des Zeichens und über das Verhältnis von Denken, Sprechen und Sein.1 Die Auseinandersetzung mit diesen sprachphilosophischen Aufgaben bringt das Hauptanliegen Platons mit sich, die Ermittlung und Vermittlung von Erkenntnis.2 Die Thematisierung von Sprache hat bei Platon eine grundlegende Bedeutung, die darüber stattfindenden Reflexionen können als „Leitfaden seines Philosophierens“3 angesehen werden,4 da Platon einen direkten Bezug zwischen einem Missverhältnis zur Sprache und einem Missverhalten zur Wahrheit und zu den Mitmenschen herstellt.5 Ohne Sprache ist Philosophie für Platon undenkbar.6
Im Folgenden werden anhand ausgewählter Schriften die wichtigsten sprachphilosophischen Fragstellungen und Ansichten Platons dargestellt: (1) Im Kratylosdialog wird das Verhältnis von Name und Ding diskutiert. (2) Im Theaitetos und Sophistes wird der Zusammenhang von Sprache und Erkenntnis erörtert. Ebenso wird Sprache als Satz thematisiert. (3) Im Phaidros und dem Siebten Brief ist eine Sprachskepsis auszumachen, zugleich tritt das λόγος-Verständnis Platons hervor. (4) Abschließend wird ein kurzer Blick auf die Rezeption der platonischen Fragestellungen geworfen.
(1) Die wichtigste Auseinandersetzung Platons mit sprachphilosophischen Fragen findet sich im Kratylos7, „dem ersten zusammenhängend überlieferten sprachphilosophischen Text der griechischen Literatur“8. Es handelt sich um ein Streitgespräch zwischen Kratylos und Hermogenes9 um die Richtigkeit von Namen, in das Sokrates verwickelt wird. Was das eigentliche Thema des Dialogs ist, ist in der Forschung umstritten. Es werden der Ursprung der Sprache, die kommunikative und wissensvermittelnde Funktion der Sprache oder die Etymologien als zentraler Inhalt herausgestellt.10 Um den Dialog richtig einordnen zu können, ist vorab in Erinnerung zu rufen, dass ὄνομα im Griechischen nicht nur Eigennamen bezeichnet, sondern allgemein ein Wort.11
Читать дальше