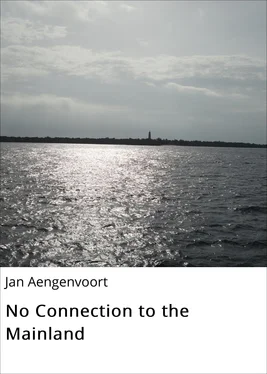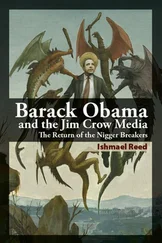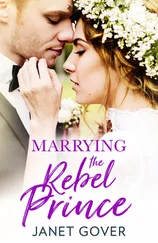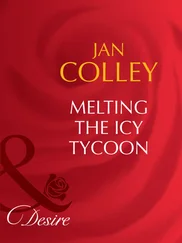Jan Aengenvoort
No Connection to the Mainland
Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis
Titel Jan Aengenvoort No Connection to the Mainland Dieses ebook wurde erstellt bei
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Impressum neobooks
Eli hatte noch gesagt, wir sollten in Dar es Salaam Geld abheben, bevor wir die Fähre nach Sansibar bestiegen. „Man weiß doch nie, wie es woanders ist“, meinte sie. Ich lachte nur, weil ich glaubte, dass sich ein wegwischendes Lachen auf einer unbeschwerten Reise in solch einem Moment gehöre. „Lass uns lieber die Sonne genießen“, raunte ich ihr auf der Kaimauer im Hafen von Dar es Salaam zu. „Und schau nur die Daus auf dem Ozean, dem Indischen Ozean, Eli, dem Indischen. Sie werden jetzt im Sommer immer nach Osten getrieben, das lernten schon die Portugiesen, als sie das erste Mal hier vorbei kamen und rüber nach Indien wollten. Wenn ich jetzt meine Coladose ins Wasser werfe, segelt sie südlich von Sri Lanka direkt bis Indonesien!“. Eli warf mir einen stummen Blick zu, der mir verbot, auch nur daran zu denken meine Coladose jetzt tatsächlich ins Wasser zu schmeißen, von wegen der Delfine und Wale und so. „Wir sollten Geld abheben“, wiederholte sie ohne die Spur eines Lächelns.
Als wir drei Stunden später in Stone Town die Fähre verließen, waren alle Geldautomaten auf der Insel ausgefallen. „There is no connection to the mainland“, klärte uns ein Wächter auf, während wir uns nicht von dem schwarzen Bildschirm des Automaten der People's Bank of Zanzibar losreißen konnten, der keinen Hinweis, keine Erklärung gab - und kein Bargeld. „No bank gives no money in Stone Town today“, schob er lachend hinterher. Es war nichts zu machen. „Wir hätten Geld auf dem Festland abheben sollen“, sagte Eli ganz beiläufig, ohne die Spur eines Vorwurfs, und ich liebte sie dafür.
Wir besaßen noch 38 Dollar, gerade genug für ein Taxi an die Ostküste, nach Jambiani oder Paje, aber wovon sollten wir dort den Wein zahlen, den gegrillten Hummer und die frischen Mangos, von denen Eli mir ständig erzählte, seitdem Navid ihr davon vorgeschwärmt hatte. 38 Dollar. Selbst ich, der ich die Aussicht gar nicht so übel fand, eine Woche lang von den 18 Dollar zu leben, die wir nach der Taxifahrt noch übrig haben würden, jede Nacht an einem anderen Strand campierend, Bananen und Mangos klauend, vielleicht sogar Kokosnüsse, wenn ich diese krummen Palmen hochkäme, selbst ich musste mir eingestehen, dass eine Hochzeitsreise anders auszusehen hat.
Wir kauften vorerst nur eine Flasche Wasser, trotteten eine Weile am Hafen herum, als ob unser angestrengtes Starren in Richtung Dar es Salaam die Verbindung zum Festland wiederherstellen könnte, schauten spöttisch den dicken Amerikanern und ein paar einheimischen Bling-Bling-Jugendlichen dabei zu, wie sie Cola und Whiskey schlürften, während wir in gemeinschaftlich beschlossenen Intervallen an unserer Wasserflasche zogen, um möglichst lange ohne weitere Ausgaben über die Runden zu kommen. Wir nickten uns bei jedem Schluck verschwörerisch zu, um anschließend in unser schelmisches Lächeln zu fallen, weil wir die Not genossen, die uns so unerwartet getroffen hatte. Eine echte Not, ein authentischer Mangel, wie selten das ist, so selten, dass wir unsere Situation als etwas Frisches, Unverbrauchtes, Neuentdecktes genossen. Bald solidarisierten wir uns mit den zwielichtigen Gestalten, die am Hafen herumlungerten, die genau wie wir gestrandet waren, etwas länger schon, aber eben auch gestrandet und mittellos im Gegensatz zur fettwanstigen Haute Volée des Geldadels im Restaurant gegenüber, und doch sprachen wir unsere Hafenbrüder nicht an, da wir noch zu frisch waren im Spiel, zu begierig, bald wieder auf die andere Seite zu wechseln.
Irgendwann begannen wir unsere Touren. Zu Fuß natürlich, innerhalb von vier Stunden drei Mal zu jedem der acht Geldautomaten der Stadt. Immer die identische Route: vom Hafen an den portugiesischen Kanonen vorbei zum omanischen Palast, zum alten britischen Konsulat, scharf links am persischen Hamam in den indischen Basar und zurück zum Hafen, immer erfolglos. „Seit tausenden Jahren ist schon alles globalisiert auf dieser Insel, aber der freie Markt ist trotzdem im Eimer“, lachte Eli, die diese politischen Spielchen liebte, auch wenn sie nur ein Witz waren, nie mehr, aber eben auch nicht weniger, wie etwa ein Schweigen, wie eine völlige Gleichgültigkeit.
In der zweiten Runde erkannten uns die Sicherheitsleute der Banken bereits, nickten uns freundlich zu. No connection to the mainland. Jedes verdammte Mal. Schließlich fragten wir in den großen Hotels, ob man uns dort Bargeld auf Kreditkartenrechnung herausgeben könnte, auf fingierte Quittungen, auf nicht verbrachte Nächte und nicht verzehrte Abendessen, aber der Rezeptionist sah uns an, als seien wir lästige Streuner. „Just wait a couple of hours“, sagte er stumpf, „just wait“.
Feodor und Anastasya waren es schließlich, die uns retteten. Wir trafen auf die beiden, als sie in der Shangani Street aus einem Taxi stiegen, unbeschwert dem Fahrer ein kleines Bündel tansanischer Schilling in die Hand drückten und schnurstracks auf eines der kleinen Touristencafés zusteuerten, die wir seit Stunden links liegen ließen. Wir müssen sie mit offenen Mündern angestarrt haben, als wären sie zwei Millionäre, die ein Fünfsternelokal aufsuchten, um dort ein paar Tausend Dollar auf den Kopf zu hauen, obwohl sie doch nur wir waren - wir mit einer Verbindung zum Festland. „Something wrong?“, fragte mich Feodor. Wir zuckten kurz zusammen, ertappt bei der Imagination fremder Genüsse, und ich musste mich tatsächlich kurz sammeln, bevor ich antworten konnte. „No, nothing wrong, it's just... no, it's nothing“, unterbrach ich mich selbst. „Common mate, let's sit together and you guys tell us what's bothering you“, schlug Feodor mit einer solchen Freundlichkeit vor, dass ich Langeweile dahinter vermutete, die Lust auf eine fremde Geschichte, die sie unterhalten, die Lust auf ein fremdes Problem, das sie lösen, belohnt mit einer Episode, die sie zu Hause erzählen würden. Eli war es, die mit einem Lächeln den Schritt in das Café tat, ganz natürlich Feodor und Anastasya folgend, wie immer pragmatischer als ich. Es war nicht ihre Art, hinter jedem selbstlosen Angebot eine Falle zu vermuten. „You won't believe what happened to us...“, sagte sie und blickte dabei unseren beiden neuen Bekannten direkt in die Augen.
Drei Stunden später saßen wir zu viert auf dem Holzdeck des Indian Pacific über der Bucht von Jambiani und schlürften Bloody Marys. „That's the life“, sagte Anastasya und zeigte auf die Daus der Fischer, die am Ende der Bucht gegen den Wind kreuzten, um weiter hinaus auf den Ozean zu gelangen, während wir den gegrillten Hummer bestellten, den Navid empfohlen hatte. Die anderen Hotelgäste, britische Kitesurfer, verstauten ihre Segel. Noch vor einer halben Stunde hatten wir sie im Ozean beobachtet. Für einen kurzen Moment waren sie geflogen, manchmal sogar einige Sekunden lang, sie hatten dann das Board hochgerissen, erst nach vorne, schließlich nach hinten, aber der Flug hatte nie so lange gewährt, wie ich es bei ihrem Absprung vermutet hatte, als die Leine des Drachens sich straffte, als das Windsegel sich prall spannte. Jetzt standen sie ein paar Schritte neben uns und rieben sich unter der Außendusche den Sand aus den Poren. Ihr lässiger Enthusiasmus ließ sie einen kurzen Moment lang sehr glücklich erscheinen.
Читать дальше