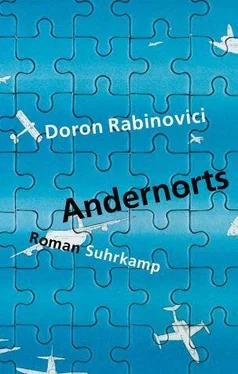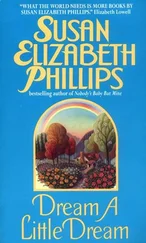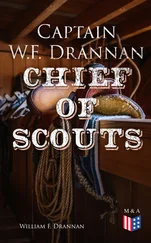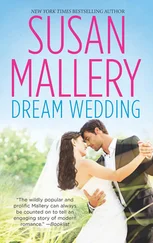Mich, Dov Zedek, den Israeli, kratzte nicht, was irgendeine Oma in Spanien daherplapperte. Die Großeltern Gerechter hätten wohl noch erschrocken nachgeschaut, um sich zu vergewissern, daß ihnen kein Klumpfuß gewachsen war. Wir lachten, als es hieß, wir hätten einen langen Schwanz am Arsch.»Nein, dort hinten ist der nicht, Senora«, spotteten wir.
Aber seit einiger Zeit ist mir, als hinge mir irgend etwas nach. Manche Menschen kommen mit Kiemen auf die Welt, andere mit dem Rest eines Schweifs, einem verlängerten Steißbein. Auch bei mir meldet sich, was überwunden schien, wieder. Der Jugendliche, der ich einst war, steht mir morgens als Leiche im Spiegel gegenüber. Unversehens spüre ich, wie er von mir Besitz ergreift. Ich merke, daß ich in den Augen der anderen nicht mehr Dov Zedek bin, ein Pionier, ein Kämpfer, sondern der Flüchtling, kein Held, sondern das Opfer, und allmählich taucht Adolf Gerechter, der Judenjunge aus Wien, in mir auf. Nach Jahrzehnten, die ich in der Wüste, unter Dattelpalmen, als Kibbuznik und in der israelischen Politik verbracht habe, schleicht er sich ein, der Vertriebene, der ich doch gar nicht gewesen sein wollte — und er verdrängt mich.
Ich zeige mich den Kindern jener, die einst meinen Tod wollten. Sie schauen auf meine Beine und meinen Arsch — und weißt du was? — sie sehen den Klumpfuß, sie entdecken den Schweif und die Satanshörner an meinem Kopf. Sie deuten darauf, aber anders als ihre Vorfahren ekeln sie sich nicht davor und hetzen dagegen, sondern raunen ehrfurchtsvoll. Sie rufen nach Adolf Gerechter und nicht nach Mord. Sie verbeugen sich tief vor mir, als wollten sie den Klotz an meinem Bein küssen.
Diese Sprößlinge christlichen Glaubens verehren mich wie einen Märtyrer. Für sie macht mich kein Fluch zum wandernden Ahasver und Handelsreisenden der Erinnerung, sondern ein Wunder. Sie zelebrieren meine Wandlung als zentrales Ritual einer Messe. Mein Leid ist für sie keine Schmach, sondern eine Passionsgeschichte. Ich wollte, ich könnte mich ihnen entziehen. Aber es ist Adolf Gerechter, der nicht nein sagen kann, wenn ich zum Gedenken gebeten werde. Er ist es, der mich jede Theatervorstellung, jede Lesung, jeden Film zu diesem Thema zu besuchen nötigt. Er ist es, der mich von einer Klasse zur anderen laufen und Jugendliche nach Auschwitz begleiten läßt. Er ist stärker als ich, als Dov Zedek. Könnte ich, so würde ich Adolf Gerechter wieder umbringen, ehe er nichts von Dov Zedek übrigläßt. Mich ermorden, um mich zu retten, das wäre die Lösung.
Hör zu, Ethan: Zuweilen nehme ich mir vor, so zu tun, als würde ich sterben, um unter einem dritten Namen und auf einem fernen Kontinent meine letzten Jahre zu genießen. Ich träume davon, Dov Zedek und Adolf Gerechter beim Schwimmen ertrinken zu lassen oder sie auf einer gemeinsamen Kreuzfahrt über Bord zu werfen. Ich würde verschwinden und andernorts auftauchen. Verstehst du? Um weiterleben zu können. Ein stiller Abschied ohne Bestattung. Meinetwegen brauchte es kein Grab und keine Trauerreden. Für mich muß kein Kaddisch gesprochen werden.
Das wachse sich aus, sagte Wilhelm Marker. Der Institutsvorsitzende hatte Ethan in sein Büro gebeten. Es gehe nicht um seine Qualifikation. Niemand zweifle an seiner Kompetenz, aber manche äußerten plötzlich Einwände. Seit jenem Kommentar werde über seine Forderungen gesprochen, über seine Gehaltsvorstellungen, immerhin deutlich über dem Niveau dessen, was am Institut sonst bezahlt werde. Es nütze nichts, darauf hinzuweisen, was ohnehin alle wüßten, daß er an anderen Universitäten noch mehr verdienen könnte. Die Stimmung sei eben umgeschlagen. Nun heiße es plötzlich, die Professur in Tel Aviv sei schlecht vereinbar mit einer Stelle hier in Wien.
«Ich halte dort nur ein Blockseminar.«
«Es sind lächerliche Sticheleien. Die Attacken zielen gar nicht so sehr auf dich. Letztlich geht es um meine Position als Institutsvorstand. «Marker beugte sich vor.»Versöhn dich mit ihm, Ethan! Schaff es aus der Welt! Hörst du? Sonst werden wir ihn nicht los. Verfasse einen offenen Brief. Erkläre darin, du hättest dein Zitat zwar wiedererkannt, ihn aber zwingen wollen, deinen Namen zu nennen. Das wird jeder einsehen. «Er raunte:»So einen muß man umarmen, sanft im Nacken fassen und dann schnell zudrücken. Du mußt ihm das Rückgrat brechen. Das ist wahre Wissenschaft. Das ist Dekonstruktion.«
Er habe auch Klausinger zu diesem Termin geladen, und noch während er das sagte, klopfte es an der Tür, und die stellvertretende Vorsitzende, Professorin Karin Furner, trat ein. Hinter ihr ein Mann, salopp gekleidet, helles Sakko, randlose eckige Brille, eine angenehm unaufdringliche Erscheinung, die so gar nicht den Vorstellungen entsprach, die Ethan sich von dem anderen gemacht hatte. Karin Furner sagte:»Darf ich vorstellen: Ethan Rosen — Rudi Klausinger.«
Die beiden nickten einander zu, und Wilhelm Marker meinte, wie gut, wenn die wechselseitigen Vorwürfe nun ausgeräumt würden. Die beiden mögen sich doch setzen, worauf Klausinger einwandte, bitte, er habe niemanden des Antisemitismus bezichtigt.
Davon sei bei ihm auch explizit nicht die Rede gewesen, sagte Ethan. Er habe einen toten Freund verteidigt.
Na, Ressentiments seien ihm schon unterstellt worden, dabei habe er nur Ethan Rosen selbst zitiert, so Klausinger.
Wilhelm Marker klopfte mit seiner Füllfeder auf den Tisch. Ob er denn nicht wisse, daß dieselben Sätze ganz anders klingen können, wenn sie aus dem Mund eines anderen kommen, fuhr er Klausinger an. Ob er noch nichts von Kontext gehört habe? Insbesondere bei so heiklen Themen.
Klausinger, sagte Karin Furner, habe immerhin in Jerusalem und in Beer Sheva gelehrt. Wenn sein Text distanzlos war, dann nur, weil er eben so vertraut sei mit israelischen Debatten. Klausinger sei, sie müsse das sagen, ein Phänomen.
«Na ja«, sagte Klausinger.
Doch, sagte Karin Furner, sie habe ihn auf internationalen Konferenzen, in London, in Paris, in Rom erlebt. Überall sei er eingetaucht in die Lebensart der Stadt, habe nicht bloß akzentfrei gesprochen, sondern auf Anhieb den lokalen Tonfall angestimmt. Sogar sein Äußeres schien sich dem jeweiligen Landescharakter angepaßt zu haben. Er sei ein Verwandlungskünstler. Und was die Frage nach einschlägigen Vorurteilen angehe: Klausinger sei immerhin Judaist, habe Modernhebräisch studiert, verstehe das Ladino der Sepharden, beherrsche aber vor allem ein Jiddisch wie nur wenige. Von ihm stammten wichtige Arbeiten über moderne Texte dieser Sprache. Es wäre durchaus denkbar, daß Klausinger über das Judentum eingehender geforscht habe als Rosen.
«Na und?«fragte Ethan. Das sei doch in der Tat gar nicht sein Gebiet. Wieso stehe diese Disziplin plötzlich zur Debatte?
«Ist alles, was ich, der Österreicher, schreibe, Ressentiment, während das, was der israelische Kollege von sich gibt, als Eigensinn und Eignung anerkannt wird? Was, wenn ich selber jüdisch wäre? Würde mein Nachruf plötzlich legitim werden? Was würden Sie sagen, wenn ich nicht jüdisch wäre, aber mein Vater sehr wohl? Nein, winken Sie nicht ab. Hören Sie zu. Was, wenn ich der uneheliche Sohn eines Überlebenden wäre? Ein Bastard. Was dann? Wenn ich seit meiner Jugend dem Liebhaber meiner Mutter nachforsche? Wenn ich meine Dutzende Würdigungen für Wiener Emigranten immer mit dem Gedanken im Hinterkopf geschrieben habe, das könnte mein Vater sein? — Vielleicht hätte ich sonst überhaupt nicht Judaistik studiert, Hebräisch gelernt und Jiddisch erforscht.«
Klausinger machte ein Gesicht, als hätte er ein intimes Geheimnis enthüllt, und Ethan fühlte sich an Gäste einer Talkshow erinnert, die, vom Beifall angeheizt, ihre obskuren sexuellen Vorlieben beichteten. Erschrocken über die eigene Courage. Wie Klausinger seine Abstammung, eine rein biologische Tatsache, präsentierte, dachte Ethan, war scheinheilig und bemüht, hatte etwas von der bigotten Enthüllung eines bloß vorgeblich verruchten Geheimnisses.
Читать дальше