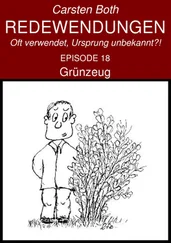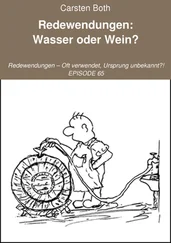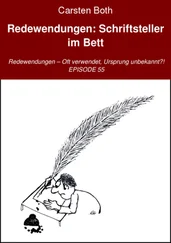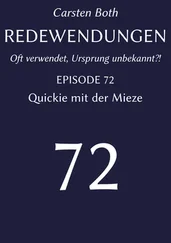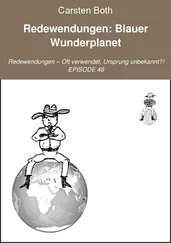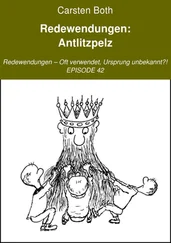Dabei dachte ich immer, die Schweden seien Spezialisten im Produzieren von leicht zerbrechlichem, billigem Mobiliar aus Spanplatten!?
Nicht nur schwedischer Stahl sondern genauso altgediente schwedische Soldaten erfreuten sich großer Beliebtheit. Zumindest bei manchem militärischen Entscheidungsträger nach Ende des Dreißigjährigen Krieges, denn die Schweden gingen aus dem langwierigen Gemetzel mit zweifelhaft-legendärem Ruf hervor ( Die Schweden kommen!!! ). Der preußische Regent Friedrich Wilhelm (1620-1688), der Große Kurfürst, war der Ansicht, auf die alten Haudegen aus Skandinavien bei der Aufstellung seines stehenden Heeres nicht verzichten zu können. Die angeworbenen kriegsbewährten „alten Schweden“ sind i.d.R. als Unteroffiziere eingesetzt worden, um die Rekruten richtig zu drillen, und schließlich wurden sie auch allseits so genannt.
Wegen dieser militärischen Ausbilder begrüßen heute einige von uns kumpelhaft einen guten/alten Bekannten mit „Alter Schwede“, oft mit einem vorangestellten „Na“ oder „Na, du“. Daneben drückt man mit dem Ausruf „Alter Schwede!“ (positives) Erstauen über etwas oder Empörung über jemanden aus.
Wir bleiben in Skandinavien, wechseln lediglich in die Nachbarnation, die ebenfalls immer noch mit einer eigenen Währung aufwartet und diese gleichermaßen als „Krone“ betitelt.
Da ist etwas faul im Staate Dänemark, wenn so ein Zwergstaat mit gerade mal ein bisschen mehr als fünf Millionen Einwohnern den Anschluss an Europa währungsmäßig verpasst, könnte man meinen.
Mit dieser Redewendung drückt man seine Vermutung aus, dass in einem bestimmten Bereich etwas nicht stimmt, dass etwas nicht in Ordnung ist, man aber (noch) nicht genau definieren kann, was denn genau da nicht stimmt.
Die Wendung stammt aus der Tragödie „Hamlet“ (1, 4) von William Shakespeare (1564-1616). Im englischen Original heißt es „Something is rotten in the state of Denmark.“ Der Ausspruch bezieht sind auf die merkwürdigen Vorgänge am dänischen Hofe, wo der König von seinem eigenen Bruder ermordet wurde und die Witwe sich mit dem Mörder verbunden hat. Andere Länder, andere Sitten.
cboth 02 0 2 ep 29 v1
Heute
bekommen
Sie es
schwarz auf weiß
, dass sehr viele Redewendungen mit der dunkelsten Farbe, die kein Licht mehr reflektiert, im Umlauf sind.
Die Wendung etwas schwarz auf weiß zu bekommen oder zu haben, also etwas Schriftliches, meist auf dem altmodischen Trägermedium namens Papier, bezieht sich auf die Druckerschwärze bzw. schwarze Tinte, die in der klassischen Form auf weißen Untergrund aufgetragen wurde und wird (obwohl natürlich heutzutage gräuliches Recyclingpapier die politisch korrektere Alternative ist!).
Allgemein bekannt geworden ist diese Redewendung, die impliziert, dass etwas Mündliches weniger wert ist, als das, was man gedruckt, schriftlich, in physischer Form vor sich liegen hat (und somit dem ausgeprägten typisch deutschen Sicherheits- und Absicherungsbedürfnis entspricht), durch eine Passage aus Goethes „Faust I“. Dort heißt es in der „Schülerszene“, Vers 1966 f.: „Denn, was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen.“ Aber schon die alten Römer sprachen von „Quod scriptura capit, firmum manet“ , „Was schriftlich festgehalten wird, bleibt sicher.“ Etwa das Kündigungsschreiben des Arbeitgebers oder die Sterbeurkunde von ...
Jedenfalls bezeichnet man einen Tag voller Hiobsbotschaften [siehe Episode 7] auch als schwarzen Tag. Bei den Römern war der „dies alter“ ein Tag, an dem man besser nicht bestimmte riskante Aktionen starten sollte. Als Beispiele werden Eheschließung und Reiseantritt genannt. Denn der römische schwarze Tag war auch ein Erinnerungstag an verlorene Schlachten, wie der wenig ruhmreichen Auseinandersetzung mit den Kelten an der Allia im Jahr 387 v.Chr. Die siegreichen Kelten hatten damals nämlich ganz Rom abgefackelt und beim enthusiastischen Brandschatzen lediglich das Capitol im Eifer des Gefechts vergessen.
Auch gegenwärtig wird das Wörtchen „schwarz“ in den meisten Fällen mit negativer Intention benutzt. Folglich wird alles, was einem nicht gefällt, konsequent schwarzge malt: Man kann etwas in den schwärzesten Farben sehenoder etwas in den schwärzesten Farben schildern/malen/darstellen, auch könnte man die bekannte rosarote Brille kurz absetzen und als Alternative mal etwas durch die schwarze Brille sehenbzw. für die Zukunft schwarzsehen, und schließlich kommen alle missliebigen natürlichen und juristischen Personen, sämtliche Verdächtige aus der Rasterfahndung auf dieoft von einem Despoten aufgestellte S chwarze Liste, die bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit durch den Initiator abgearbeitet wird.
Diese dunkle Liste voller Dunkelmänner und -frauen soll erst in jüngerer Zeit in unseren Wortschatz Eingang gefunden haben. Vorbote der Wendung waren Verbindungen von Begriffen wie „Buch“, „Tafel“, „Register“ u.Ä. mit dem Adjektiv „schwarz“. So wurde etwa ein Gerichts- und Strafbuch, in dem Bußen und Strafen erwischter Sünder verzeichnet waren, als „schwarzes Buch“ bezeichnet. Das Brüderpaar Grimm spekuliert in der legendären Publikation „Das Deutsche Wörterbuch“, dass die Bezeichnung möglicherweise „zunächst auf den Einband“ zurückgeht, „aber die Farbe des Einbands hat dann eine symbolische Bedeutung (...), die schwarze, die des Unheilvollen.“
Da wir gerade bei einem berühmten Buch sind: Die S chwarze Kunstmeinte früher das Buchdruckerwesen, wegen der Druckerschwärze. Heute würde man wohl eher an etwas völlig anderes denken, denn die schwarze Kunst steht auch für Zauberei und Magie. Esoterik ist bekanntlich in und trendy, die Staatskirche völlig out und uncool!
Die Wendung an sich scheint auf die volkstümliche Missdeutung des Fremdwortes „Nekromantie“, die Totenbeschwörung ( necromantia), zurückzugehen. Der Begriff wurde vom gemeinen Volk (absichtlich?) als „Negromantie“ bzw. „Nigromantie“ missverstanden. Aus dem Lateinischen kam es dann zur Fehlübersetzung „schwarze Kunst“, da das lateinische „niger“ für „schwarz“ steht und „manus“ u.a. für „Werk/künstlerische Leistung“.
Heute spricht man, sozusagen als Gegensatz zur „guten Hexerei“ (Weiße Magie), auch des Öfteren gleich direkt von Schwarzer Magie, der „bösen Hexerei“.
Unsere Jugend kennt sich bestens mit solcherlei verwerflichen, da unchristlichen, nicht staatlich autorisierten Eskamotagen aus; die feiert nämlich ab und an eine Schwarze Messe. Diese Art der gemütlichen Abendgestaltung, die jedes Jugendzentrum, das etwas auf sich hält, im Angebot hat, wird vom Teufel [vgl. Episode 2] persönlich geleitet. Mein altes Taschenlexikon beschreibt die traditionelle Teufelsmesse als „vom Mittelalter bis ins 19. Jh. zu Ehren des Teufels oder einer Hexe begangene, der katholischen Messfeier nachgebildete orgiastische und obszöne Feier.“
Das klingt doch interessant! (In der Neuauflage steht bestimmt auch schon 21. Jh. ) Die Attraktivität dieser Art von Seminaren kommt wahrscheinlich ebenso daher, dass der Besucher bei jener kreativen Modifikation der kirchlichen Messe nicht regelmäßig per herumgereichtem Klingelbeutel angebettelt wird, und das auch dann, wenn dieser sowieso schon Kirchensteuer und Ablassgelder entrichten musste. Und natürlich, weil echtes Blut statt billiger Rotwein gereicht wird.
Читать дальше