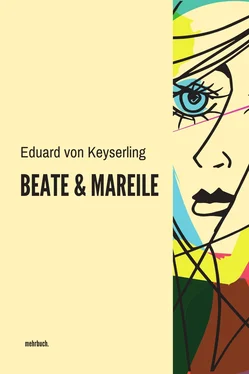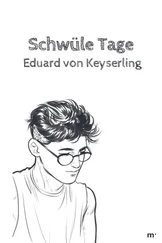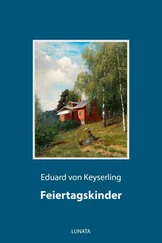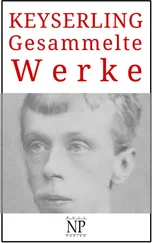Graf Botho, Günthers Vater, war mit einer italienischen Prinzessin vermählt gewesen; ein herrliches Geschöpf, wie Fra Sebastiano sie gerne malte: königliche, edelsteinharte Augen, eine bleiche Gesichtsfarbe, in die sich etwas wie grünliches Gold mischt. Die schöne Römerin konnte deutsche Luft und deutsche Menschen nicht vertragen. Getrennt von ihrem Gatten lebte sie mit ihrem einzigen Kinde, dem kleinen Günther, in ihrer Heimat. Noch jung erlag sie einem Brustleiden. Lantin hatte von seiner Herrschaft wenig gesehen. Jetzt langte Graf Botho in Lantin an mit seinem Kinde, dem Sarg seiner Frau und Komtesse Benigne, seiner alten Schwester. Der Sarg wurde in der Familiengruft beigesetzt, Benigne mit dem Kinde im Schloß eingerichtet, und dann reiste Graf Botho wieder ab.
Hier verbrachte Günther seine Kindheit. Damals war es, daß er seine ersten Spiele mit Beate und Mareile, der braunen Inspektorstochter, zwischen den Levkojen und Lilienbeeten des Kaltiner Gartens spielte.
Die Baronin von Losnitz, früh verwitwet, lebte mit ihrer einzigen Tochter in Kaltin. Komtesse Seneïde Sallen, ihre Schwester, wohnte bei ihr. Irgendeine brutale Liebesgeschichte war in das stille Leben des Landfräuleins eingeschlagen und hatte es seelisch und geistig gebrochen. Jetzt lebte sie hier. Friedliche Beschäftigungen, die freundliche Narkose der Religion erhielten das Gleichgewicht dieses kranken Geistes.
Schloß Lantin wurde unterdes wieder leer. Komtesse Benigne starb, und Günther wurde in die Stadt gegeben. Lantin sah seinen Herrn zwar noch einmal, allein unter wunderlichen Umständen, wieder. Graf Botho langte mit einer fremden, schwarzlockigen Dame an. Frau Kulmann, Kastellanin und Kammerdienergattin, verstand es, ein undurchdringliches Dunkel um die Fremde zu breiten. Die Leute schüttelten die Köpfe. Begegneten sie dem Paar, dann rückten sie an den Mützen, verzogen jedoch höhnisch die Mäuler. Mankow, der Wildhüter und Vertraute des Grafen, erzählte abends im Waldkruge unheimliche Geschichten von der »verfluchten Schwarzen«. Über dem Portal des Schlosses hing in bemaltem Stein das Tarniffsche Wappen: auf dem Tartschenschilde in goldenem Felde drei schwarze Lindenblätter, darüber, auf gekröntem Stechhelm, zwischen dem offenen, goldenen Flug ein wachsender, schwarzer Brackenhals. »Die drei herzförmigen Blätter«, sagten die Lantiner, »sind die drei Weiberherzen, die jeder Tarniff bricht.« - »Ja«, sagte Mankow, »und der Hund da oben, das ist der Teufel, der sie holt. Unser Alter hat sich seinen Teufel selber mitgebracht.« Die Sache nahm kein gutes Ende: »So verfault is unser Alter auch noch nich«, meinte Mankow. »Was zu doll is, is zu doll! Das schwarze Aas hat die Reitpeitsch, die mit dem goldenen Knopf, wißt ihr, zu schmecken gekriegt.« Eine verschlossene Kutsche brachte die Schwarze eines Morgens zur Station. Der alte Herr verschloß sich in seine Gemächer, dann reiste er ab, kam wieder, vergrub sich in seine Bücher: »Alt is 'r«, sagte Mankow. »Er sagt, er hat das Leben satt. Muß der gefressen haben! Was? Jetzt sitzt er bei den Büchern, und das ist das Letzte.« Ein Schlaganfall beraubte den alten Herrn seiner Füße. Stundenlang schob Kulmann ihn im Rollstuhl die Alleen des Parkes auf und ab, und das große, bleiche Greisenantlitz wackelte mißmutig und ergeben bei jeder Bewegung des Rollstuhles. Endlich kam das Ende. Kulmann hatte seinen Herrn eines Nachmittags allein im Park gelassen, um zu Hause einen Grog zu trinken. Das mochte ein wenig lange gedauert haben. Als Kulmann gegen Abend seinen Grafen aufsuchte, fand er ihn in der Herbstdämmerung tot im Rollstuhl sitzen, feucht von Abendnebeln, überstreut von Herbstblättern, und den goldenen Knopf der Reitpeitsche fest zwischen die Zähne geklemmt.
Günther mied das Schloß. Frau Kulmann kämpfte mit Staub und Motten und dachte an lustigere Zeiten, da sie jung war und dem seligen Herrn gefiel.
Günther erwuchs zu einem sehr glänzenden Ulanenoffizier. Er durchspähte das Leben mit leidenschaftlicher Hast nach Genüssen, als fürchtete er beständig, irgendein Genuß, ein seltenes Glück könnte ihm unterschlagen werden. Nach einigen Jahren hieß es, seiner Gesundheit halber müsse er den Dienst verlassen. Andere erzählten, seine Beziehungen zu einer hochstehenden Dame hätten seine Entfernung aus Berlin wünschenswert gemacht. Er ging nach Athen, bei der Gesandtschaft diplomatische Kenntnisse zu sammeln. Einige Winter später trafen die Jugendgespielen sich in Berlin. Frau von Losnitz wollte Beate in die Gesellschaft einführen. Günther befand sich gerade in einer Krisis, die bei solchen nervösen, allzu gierigen Lebenstrinkern gegen Ende der zwanziger Jahre einzutreten pflegt. Er war satt. Von jeher hatte er das Weib für die Verschleißerin der wichtigsten Genüsse des Lebens angesehen. Für jede Stimmung das richtige Weib zu finden erschien ihm als die bedeutsamste Kunst; und urplötzlich war er der Weiber so müde: »Es ist doch in der ganzen Welt immer wieder dieselbe kleine Schauspielerin mit den gemalten Augenbrauen und den geldgierigen Taubenaugen«, meinte er. »Ich kann Dir sagen«, schrieb er an den Maler Hans Berkow, seinen Freund, »ich gehe den Weibern wie einer Drehorgel, die eine zu oft gehörte Melodie spielt, aus dem Wege. Ich kann nur noch mit den stillen, kühlen Marmordamen im Museum verkehren.« In dieser Gemütslage mußte Beate stark auf Günther wirken. Dieses Mädchen, mit einer stilvollen Reinheit, schien ihm ein Glück zu versprechen, das ihm wirklich bisher unterschlagen worden war. »Sie ist ja die adelige Poesie in Person«, sagte er, denn er liebte die geschmückten Redewendungen. Einen schwungvolleren Bewerber hatte die kühle Berliner Gesellschaft noch nicht gesehen: »Je nun!« sagte der Fürst Kornowitz, »wir haben bei unseren Damen schon alle möglichen Manieren versucht, Jockeymanieren, Künstlermanieren, Dekadenzmanieren. Der Tarniff scheint die Troubadourmanier aufbringen zu wollen. Keine bequeme Manier das.«
Beate nahm Günthers Werbung in ihrer wohlerzogenen Art hin. In den Schlössern unseres Landadels wachsen noch, unter feiner berechneter Obhut, solche Mädchen von wunderbar naiver Reinheit heran. Das Gute und Schöne erwarten sie von dem Leben, wie das Selbstverständliche, und Günther erschien Beate als dieses Schöne und Gute. Im Winter verlobten sie sich, im April wurden sie getraut, und im Juli des nächsten Jahres zog Günther nach Kaltin, entschlossen, dort ein glückliches Familienleben zu führen nach wohlbewährtem, altadeligem Rezepte.
Die alte Baronin von Losnitz saß in ihrem Voltairesessel und strickte einen blauen Kinderstrumpf. Schöne Haartrompeten, blank und weiß, rahmten das fette, weiße Gesicht mit den regelmäßigen Zügen ein. Seneïde saß am Fenster und nähte. Ihre Züge waren scharf und gezogen, die Lippen fast weiß, und die Augen lagen tief in den Höhlen und gaben dem Gesichte einen kummervoll-erregten Ausdruck. Sie legte ihren Fingerhut mit einem lauten »Klap« auf den Tisch, lehnte den Kopf zurück und schloß die Augen. »Beating«, begann sie, »war heute wieder wie sonst. Gestern, da war etwas Fremdes in ihrem Gesichte - etwas - ich weiß nicht?«
Die Baronin schaute ihre Schwester über die Brille hinweg an: »Hör, Seneïdchen, du machst die Dinge gern geheimnisvoll. Für ein junges Ehepaar ist das nichts. In deiner Milchkammer rührst du auch nicht in den Töpfen herum; du wartest doch ruhig, bis die Sahne sich absteht. Na - also!«
Seneïde beugte sich still auf ihre Arbeit nieder.
Nun kamen Günther und Beate. Günther begann sofort die alten Damen zu bezaubern. Nichts im Leben war ihm ungemütlicher, als wenn er nicht gefiel. Bei der Toilette bemühte er sich, Peter zu gefallen, und auf der Reise dem Schaffner. »O Mama, wie blühend du aussiehst, hübsch und sommerlich. Und Tante - Ihr Harmonium habe ich heute früh schon im Bette gehört. Geradezu heilig hab' ich dabei geschlafen - auf Ehre. Gott, hier muß man ja gut sein.«
Читать дальше