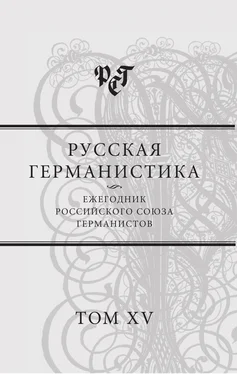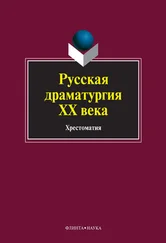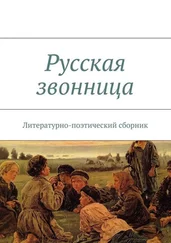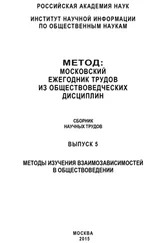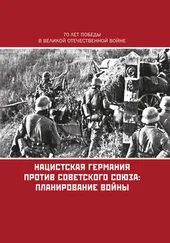‚Evolution‘ hingegen gehört zu jenen in der Sattelzeit neu entstehenden Begriffen, die die Last der metaphysisch-ontologischen Tradition, die man eigentlich abwerfen wollte, in einem modernen Begriffsdesign fortschrieben. ‚Entwicklung‘ und ‚Entfaltung‘ sind ohne metaphysische Fundamentalannahmen gar nicht denkbar. Was sich entwickeln, entfalten soll, muss der Essenz nach bereits wesenhaft vorhanden sein, wie Sartre gesagt hätte. Das gilt für den Samen der Pflanze wie für die Individualität des Individuums. Der Keim trägt bereits das Programm, nur blendet die Moderne die alten Fragen aus, wer dieses Programm dort eingeschrieben hat und zu welchem Zweck, nach welchem Plan.
3. Geschichtsphilosophie
Im Bereich der Geschichtsphilosophie lässt sich kurz zeigen, dass mit der Wahl zwischen den Prinzipien von ‚Revolution‘ und ‚Evolution‘ auch in der Moderne gänzlich unterschiedliche Weltzugänge oder Weltdeutungsmuster verbunden sind. Wir wenden uns zur Verdeutlichung Goethe zu:
es liegt nun einmal in meiner Natur, ich will lieber eine Ungerechtigkeit begehen, als Unordnung ertragen [Goethe 1987, I/33: 315].
Zuletzt hat Gustav Seibt [2014] in seinem Buch Goethe in der Revolution alle historischen Bezüge entfaltet, die diesem berühmten Diktum aus Goethes Belagerung von Mainz eingeschrieben sind. Genau betrachtet, betrifft jedoch vor allem der erste Teil, das Begehen einer Ungerechtigkeit, die Sphäre des Geschichtlichen oder Politischen, die Goethe als nicht mehr steuerbaren Ausbruch von Partikularinteressen, als Wüten individueller Egoismen und demagogisch verführter Köpfe auffasste; dort konnte, ja musste „Ungerechtigkeit“ geschehen. Der zweite Teil aber, die Nichtanerkennung von „Unordnung“, meint hingegen das Übergeschichtliche, die alles durchdringende Ordnungsstruktur der Welt oder der „Natur“, deren gesicherte Existenz Goethe unter gar keinen Umständen ableugnen wollte.
Diese Ordnungsstruktur der Natur war in der Vormoderne immer auf ihren Schöpfer zurückgeführt worden, ganz egal ob man Gott als großen Baumeister und Ingenieur verehrte – man denke an die Uhr im Straßburger Münster – oder sich in der Physikotheologie dem „irdischen Vergnügen in Gott“ [vgl. Brockes 1721–48] hingab, indem man die Natur als zweites Buch Gottes las. Die moderne Reformulierung dieses Problems lernten Goethe wie seine Zeitgenossen von Spinoza, der in seiner Formel „deus sive natura“ Gott in ein philosophisches Prinzip verwandelte, in die wirkende Kraft in der Natur, die „natura naturans“. Ihre vormodern-metaphysische Problemlast hatten diese neuen Begriffe keineswegs abgeworfen, doch versprach ihr modernes Design, die alten metaphysischen Fragen wenigstens verschatten zu können. Das war die Art protestantischer ‚Privatreligion‘ (Goethes eigener Begriff: „Christenthum zu meinem Privatgebrauch“ [Goethe 1987, I/28: 306]), die schon Lessing für sich in Anspruch genommen hatte, als der das anthropomorphe Wesen, das im Himmel säße und auf die Menschlein herabsähe, als religiöse Zumutung abwies. Identifizieren konnte er sich hingegen mit Spinozas philosophischer Schwundstufe, mit einem Numinosen als wirkender Kraft, und meinte, damit auf dem Weg der Selbstbeschreibung der Vernunft im Projekt der Aufklärung einen großen Schritt weitergekommen zu sein. Auch für Goethe bleibt dieses salonfähige Numinose Spinozas letzter Garant einer Ordnungsstruktur in der Natur, ohne die ‚Evolution‘ nicht denkbar wäre.
Selbst der große Antimetaphysiker Immanuel Kant, der meinte, dass die Ordnung der Welt gar nicht Gegenstand der Philosophie sein könne, da uns das Ding an sich nicht zugänglich sei, und Philosophie sich stattdessen mit der Ordnung unseres Denkens beschäftigen müsse, behält denselben dünnen Halm in der Hand. Denn auch er stand vor dem Problem, warum diese Ordnung des Denkens irgendwie relevant sein soll für die Erkenntnis der Ordnung der Dinge, der Ordnung des Seins. Taugt Philosophie nach der kopernikanischen Wende überhaupt noch zu irgendetwas – außer dazu, sich mit sich selbst zu beschäftigen? Den Preis einer verneinenden Antwort will Kant natürlich nicht zahlen, und so behauptet auch er – ganz in theologisch-metaphysischer Tradition – eine Korrespondenz zwischen der Ordnung des Denkens und der Ordnung des Seins. Aber wer hätte diese gestiftet? An seiner Antwort in der Kritik der reinen Vernunft ist das Gequälte nicht zu übersehen: Er komme nicht umhin, die „Idee einer höchsten und schlechthin notwendigen Vollkommenheit eines Urwesens [anzuerkennen], welches der Ursprung aller Kausalität ist“ [Kant 1998, II/599] und somit den „Grund der Weltordnung und ihres Zusammenhanges nach allgemeinen Gesetzen enthalte“ [Kant 1998, II/600]. Nur nennt er diesen „Urgrund“ nicht mehr vormodern ‚Gott‘, sondern modern „intellectus archetypus“ [Kant 1998, II/600], womit wir einen weiteren Begriff aus der Sattelzeit haben, der vormoderne Metaphysik nicht abwirft, sondern lediglich in modernem Begriffsdesign verschattet.
Exakt dieser Befund gilt auch für den ‚Evolutions‘-Begriff in der modernen Literaturgeschichtsschreibung und Literaturwissenschaft. Doch auf dem Weg zu Veselovskij, Curtius und Ėjchenbaum bedarf es noch einer Zwischenstation.
4. Holismus
Der größere Bruder des ‚Evolutions‘-Begriffs ist das philosophische Konzept des Holismus. Entsprechend nannte Jan Christian Smuts sein 1924 erschienenes Hauptwerk Holism and Evolution . Danach meint ‚Holismus‘ die Grundauffassung, dass „alle Daseinsformen […] danach streben, Ganze zu sein“ [zit. n. Goerdt 1974: 1167]. Und dieses ‚Ganze‘ ist mehr als die Summe seiner Teile, ihm eignet vielmehr eine eigene Qualität. Der Zusammenhang mit ‚Evolution‘ im Sinne von ‚Entfaltung‘, ‚Entwicklung‘ ist ein logischer: Ohne den holistischen Überbau könnte man nur ‚Veränderung‘ feststellen; ‚Evolution‘ aber ist ein substantialistischer Begriff, der die Veränderung in eine gegebene Ordnung einbettet, eine Ordnung, die die Gültigkeit der – wie auch immer definierten – Evolutionsgesetze garantiert. Selbstverständlich ist auch ‚Holism‘ ein moderner Begriff, der alte metaphysische Probleme nicht löst oder abwirft, sondern in modernem Design reformuliert.
Auch wenn das Wort ‚Holism‘ jung ist, gab es holistisches Denken schon sehr viel früher. Goethes Faust bestaunt das Zeichen des Makrokosmos mit den Worten:
Wie alles sich zum Ganzen webt,
Eins in dem andern wirkt und lebt! [Goethe 1987, I/14: 30]
Dabei wusste Goethe sehr wohl um die metaphysische Dimension dieses holistischen Denkansatzes. In den Zahmen Xenien heißt es entsprechend:
Sagst Du: Gott! So sprichst Du vom Ganzen [Goethe 1987, I/5,1: 144].
Oder weniger poetisch in seinen Spinoza-Studien:
In jedem lebendigen Wesen sind das, was wir Theile nennen, der-gestalt unzertrennlich vom Ganzen, daß sie nur in und mit demselben begriffen werden können, und es können weder die Theile zum Maß des Ganzen noch das Ganze zum Maß der Theile angewendet werden [Goethe 1987, II/11: 317].
Das gilt analog für das Individuum im Verhältnis zum Ganzen seiner geschichtlichen Umwelt, was uns hier nicht weiter interessiert; es gilt aber auch für das Kunstwerk als kleine Schöpfung des Künstlers im Verhältnis zur Welt als großer Schöpfung Gottes:
Jedes Schöne Ganze der Kunst ist im Kleinen ein Abdruck des höchsten Schönen, im Ganzen der Natur [Goethe 1987, I/47: 86].
5. (Literatur-)Geschichtsschreibung, Literaturtheorie
Holistisches Denken gewann eine neue Qualität, als man es verzeitlichte. Für das alte synchrone Ordnungsdenken steht das Modell der Botanisiertrommel. Man zog durch die Natur und sammelte Versatzstücke ein, die man dann klassifizieren und kartographieren konnte, um das große Ganze des Ordnungszusammenhangs wieder sichtbar zu machen.
Читать дальше